
Deutsche Enzyklopädie
 Economy and trade
Economy and trade

 Germany
Germany

 European Union
European Union

 Financial
Financial
 *Germany economic data
*Germany economic data

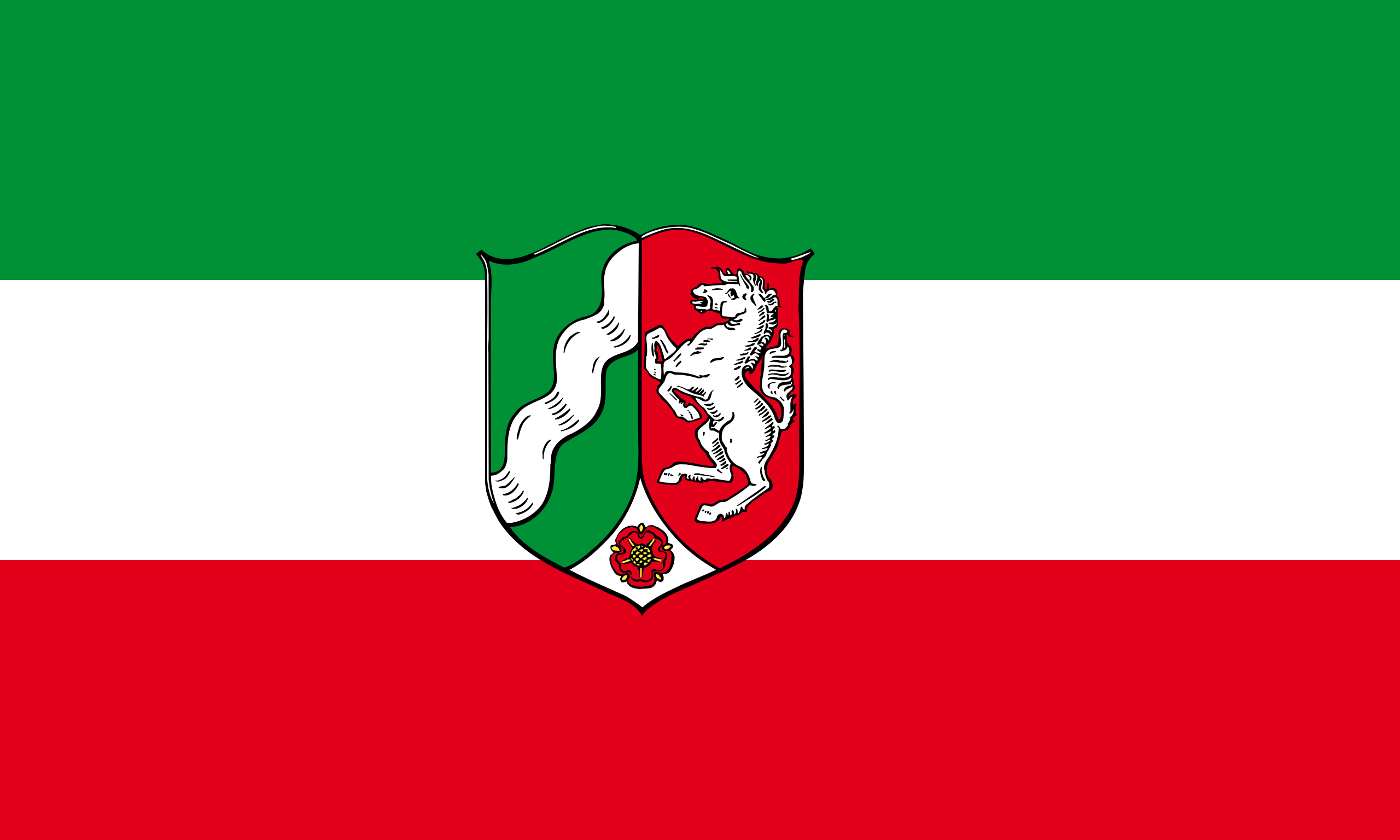 North Rhine-Westphalia
North Rhine-Westphalia

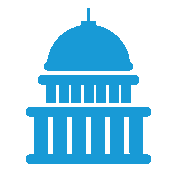 Party and government
Party and government
 *Think Tank
*Think Tank

 Economy and trade
Economy and trade
 Economic and political research
Economic and political research

Das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Bonn.
Es setzt sich für die Förderung von Frieden und Entwicklung ein und zählt neben dem Institut für Entwicklung und Frieden, der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V., dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) und der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) zu den fünf führenden deutschen Friedensforschungsinstituten
 *Think tanks in Germany
*Think tanks in Germany

 Berlin
Berlin

 Education and Research
Education and Research

 European Union
European Union

 Financial
Financial
 *Germany economic data
*Germany economic data

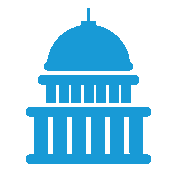 Party and government
Party and government
 *Think Tank
*Think Tank

 Economy and trade
Economy and trade
 Economic and political research
Economic and political research

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) ist ein Netzwerk und eine Denkfabrik für Außenpolitik. Die 1955 in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign Relations und Chatham House gegründete Gesellschaft betreibt Forschungseinrichtungen für Fragen der internationalen Politik sowie der Außen- und Sicherheitspolitik. Die DGAP zählt heute über 2.800 Mitglieder, darunter führende Persönlichkeiten aus dem Bank- und Finanzwesen, der Wirtschaft, Politik, Medien und der Wissenschaft.[1] Sitz der DGAP ist das ehemalige Gebäude der Jugoslawischen Gesandtschaft im Botschaftsviertel in Berlin-Tiergarten.
 *European Union
*European Union
 Belgium
Belgium
 Belgium
Belgium
 Denmark
Denmark
 Germany
Germany
 Estonia
Estonia

 European Union
European Union
 Member States of the European Union
Member States of the European Union
 Finland
Finland
 France
France

 History
History

 History
History

 History
History
 N 2000 - 2100 AD
N 2000 - 2100 AD
 Greece
Greece

 Hand in Hand
Hand in Hand
 Holland
Holland
 Ireland
Ireland
 Italy
Italy
 Croatia
Croatia
 Latvia
Latvia
 Lithuania
Lithuania
 Luxembourg
Luxembourg
 Malta
Malta
 Nobel prize
Nobel prize
 2012
2012
 Nobel prize
Nobel prize
 Nobel Peace Prize
Nobel Peace Prize
 Austria
Austria

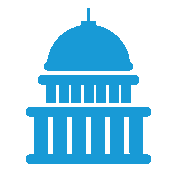 Party and government
Party and government

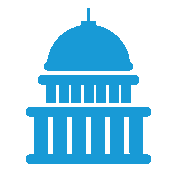 Party and government
Party and government
 Group of the twenty most important industrial and emerging countries
Group of the twenty most important industrial and emerging countries

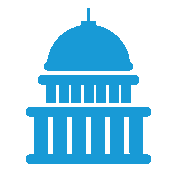 Party and government
Party and government
 Group of Seven,G7
Group of Seven,G7
 Poland
Poland
 Portugal
Portugal
 Romania
Romania
 Sweden
Sweden
 Slovakia
Slovakia
 Slovenia
Slovenia
 Spain
Spain
 Czech Republic
Czech Republic
 Hungary
Hungary

 Economy and trade
Economy and trade
 Free trade agreement
Free trade agreement
 Cyprus
Cyprus
 Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]
Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]
Das politische System der EU, das sich im Zuge der europäischen Integration herausgebildet hat, basiert auf dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Es enthält sowohl überstaatliche als auch zwischenstaatliche Elemente. Während im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union die einzelnen Staaten mit ihren Regierungen vertreten sind, repräsentiert das Europäische Parlament bei der Rechtsetzung der EU unmittelbar die Unionsbürger. Die Europäische Kommission als Exekutivorgan und der EU-Gerichtshof als Rechtsprechungsinstanz sind ebenfalls überstaatliche Einrichtungen.
Die Anfänge der EU gehen auf die 1950er-Jahre zurück, als zunächst sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten. Eine gezielte wirtschaftliche Verflechtung sollte militärische Konflikte für die Zukunft verhindern und durch den größeren Markt das Wirtschaftswachstum beschleunigen und damit den Wohlstand der Bürger steigern. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte traten in mehreren Erweiterungsrunden weitere Staaten den Gemeinschaften (EG) bei. Ab 1985 wurden mit dem Schengener Übereinkommen die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedsländern geöffnet. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beziehungsweise der Auflösung des Ostblockes im Jahr 1989 änderte sich die geopolitische Lage in Europa grundlegend, womit sich Möglichkeiten zur Vertiefung der Integration, aber auch zur Vorbereitung von Erweiterungen im Osten ergaben. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 die Europäische Union gegründet, die damit Zuständigkeiten in nichtwirtschaftlichen Politikbereichen bekam. In mehreren Reformverträgen, zuletzt im Vertrag von Lissabon, wurden die überstaatlichen Zuständigkeiten der EU ausgebaut und die demokratische Verankerung der politischen Entscheidungsprozesse auf Unionsebene nachgebessert, vor allem durch nochmalige Stärkung der Stellung des Europäischen Parlaments. Eine europäische Öffentlichkeit und Identität als Voraussetzung einer supranationalen Volkssouveränität bildet sich indes erst allmählich und nicht ohne Gegenströmungen heraus. Seit den 1980er-Jahren nahm mit den Kompetenzerweiterungen und dem damit einhergehenden Bedeutungsgewinn der EU auch die öffentliche Debatte über die Verfasstheit der EU an Intensität zu; dabei wurden auch EU-skeptische Positionen vermehrt artikuliert. Im Vertrag von Lissabon wurden im Jahr 2007 auch Austrittsszenarien geregelt.
Von den 28 EU-Staaten bilden 19 Staaten eine Wirtschafts- und Währungsunion. Im Jahr 2002 wurde eine gemeinsame Währung für diese Länder, der Euro, eingeführt. Im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts arbeiten die EU-Mitgliedstaaten in der Innen- und Justizpolitik zusammen. Durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bemühen sie sich um ein gemeinsames Auftreten gegenüber Drittstaaten. Zukunftsbezogenes gemeinsames Handeln ist Gegenstand der Initiative Europa 2020, zu der unter anderem die Digitalpolitik gehört. Die Europäische Union hat Beobachterstatus in der G7, ist Mitglied in der G20 und vertritt ihre Mitgliedstaaten in der Welthandelsorganisation.
Die EU war 2016 der weltweit zweitgrößte Wirtschaftsraum nach nominalem (hinter den USA) sowie kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (hinter der Volksrepublik China). Als Staatenverbund ist sie der größte Güterproduzent und die größte Handelsmacht der Welt. Die Mitgliedsstaaten haben einen der höchsten Lebensstandards weltweit, wobei es jedoch auch innerhalb der EU deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern gibt. Im Index der menschlichen Entwicklung galten 2015 26 der 28 Mitgliedstaaten als „sehr hoch“ entwickelt.
Nach der Osterweiterung in den Jahren 2004 und 2007 ist die Europäische Union infolge der Finanzkrise ab 2007 und durch die Flüchtlingskrise ab 2015 in verschiedenen Mitgliedsstaaten einer zunehmenden EU-Skepsis von Teilen der Bevölkerung ausgesetzt, die sich unter anderem in dem Brexit-Referendum von 2016 niedergeschlagen hat. Unter dem Eindruck der Krisenerscheinungen und der Zunahme von rechtspopulistischen Tendenzen in den Mitgliedstaaten der Union wird die EU-Finalitätsdebatte neuerlich intensiv geführt. Einen auf die nähere Zukunft gerichteten, stark beachteten Reformplan hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Initiative für Europa vorgelegt.
 Argentina
Argentina
 Australia
Australia
 Brazil
Brazil
 China
China
 Germany
Germany
 England
England

 European Union
European Union
 France
France

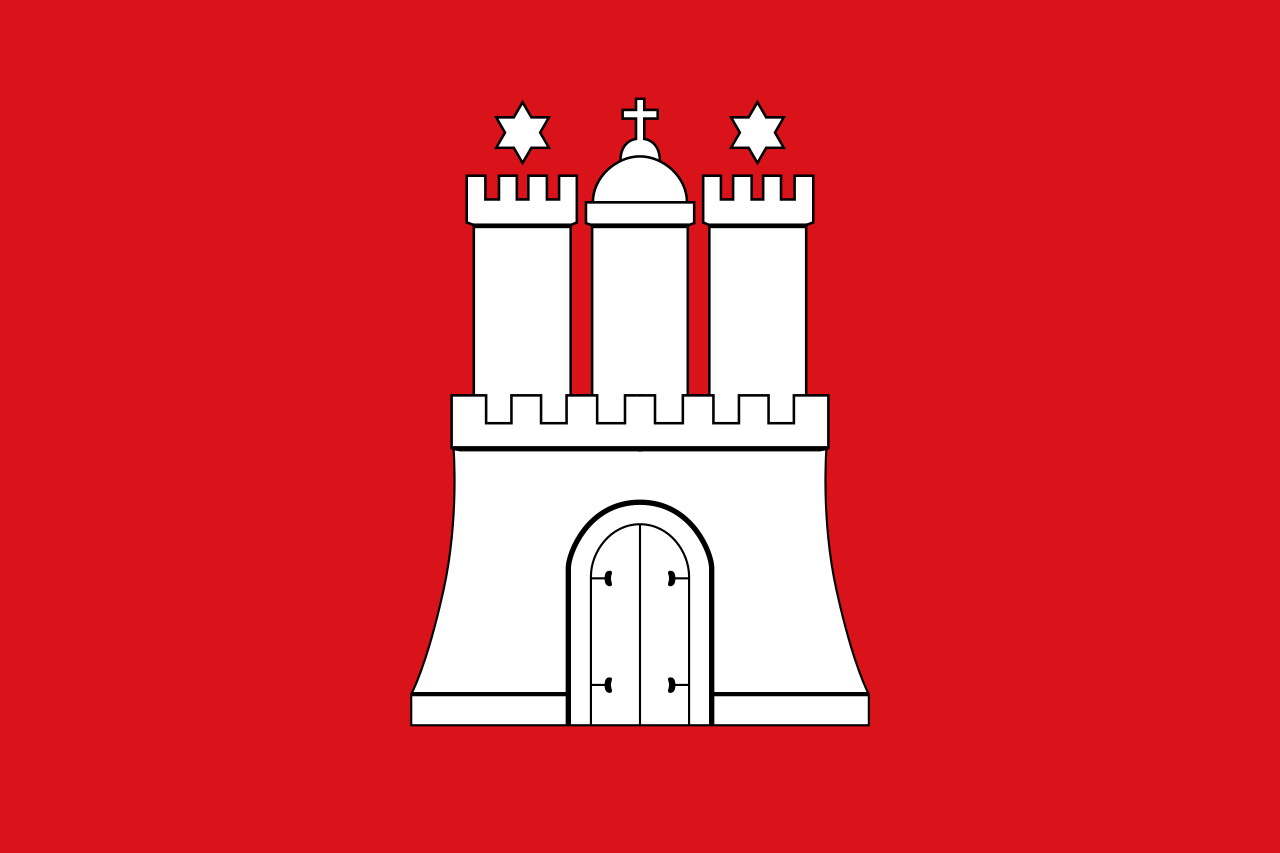 Hamburg
Hamburg

 Hand in Hand
Hand in Hand
 India
India
 Indonesia
Indonesia
 Italy
Italy
 Japan
Japan
 Canada
Canada
 Mexico
Mexico

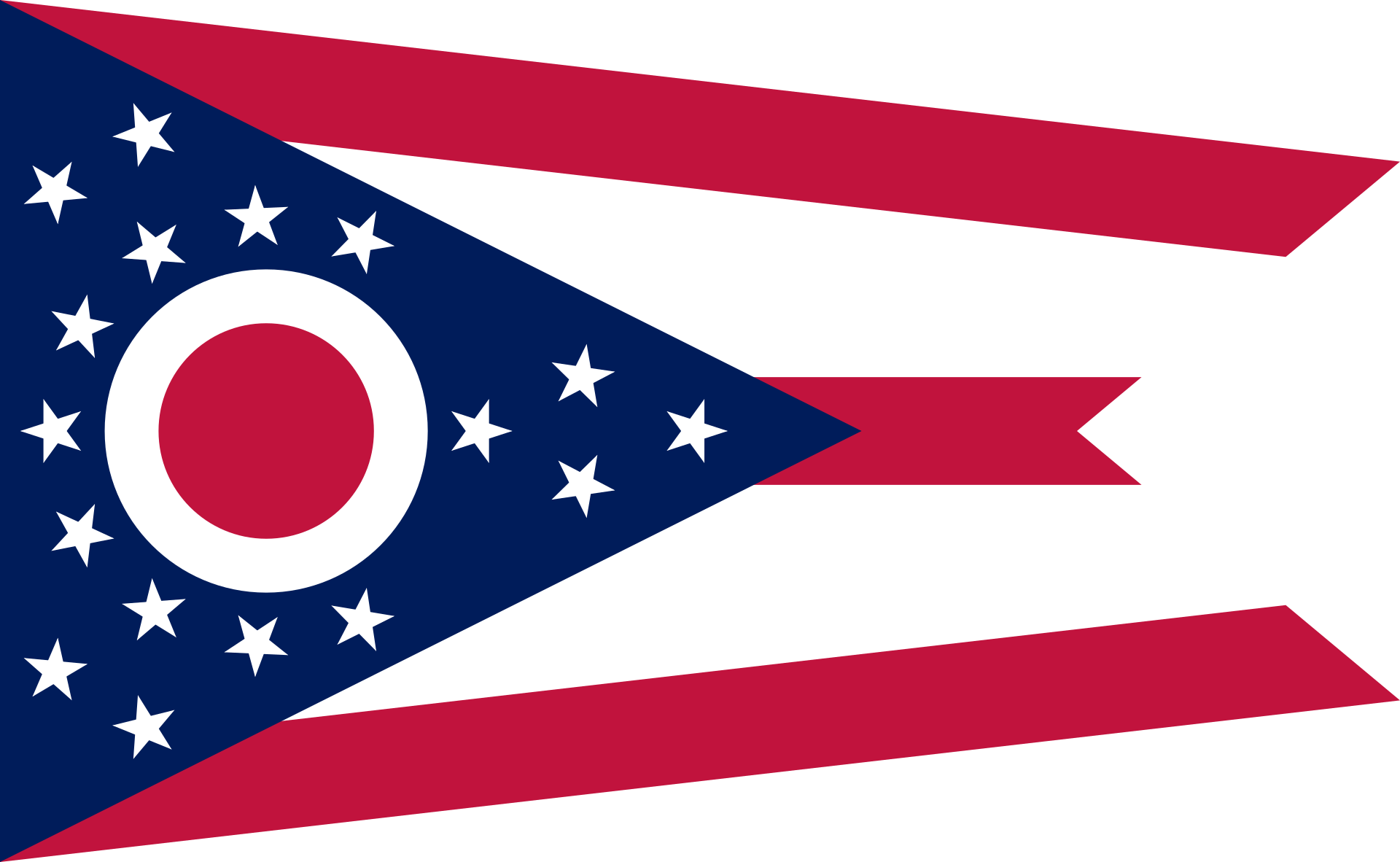 Ohio-OH
Ohio-OH

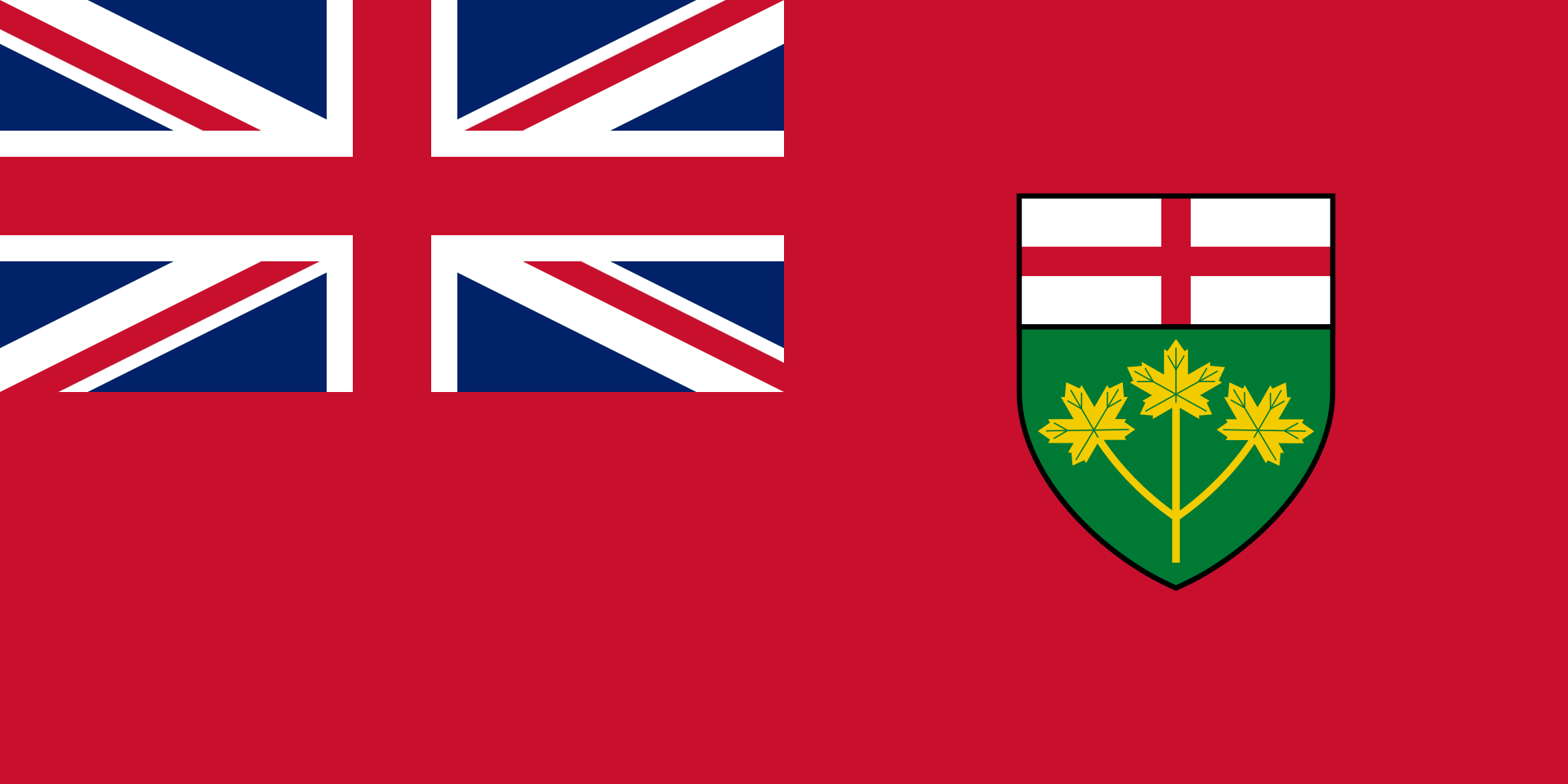 Ontario-ON
Ontario-ON

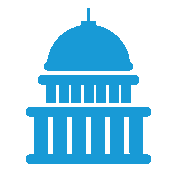 Party and government
Party and government

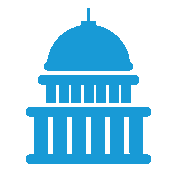 Party and government
Party and government
 Group of the twenty most important industrial and emerging countries
Group of the twenty most important industrial and emerging countries

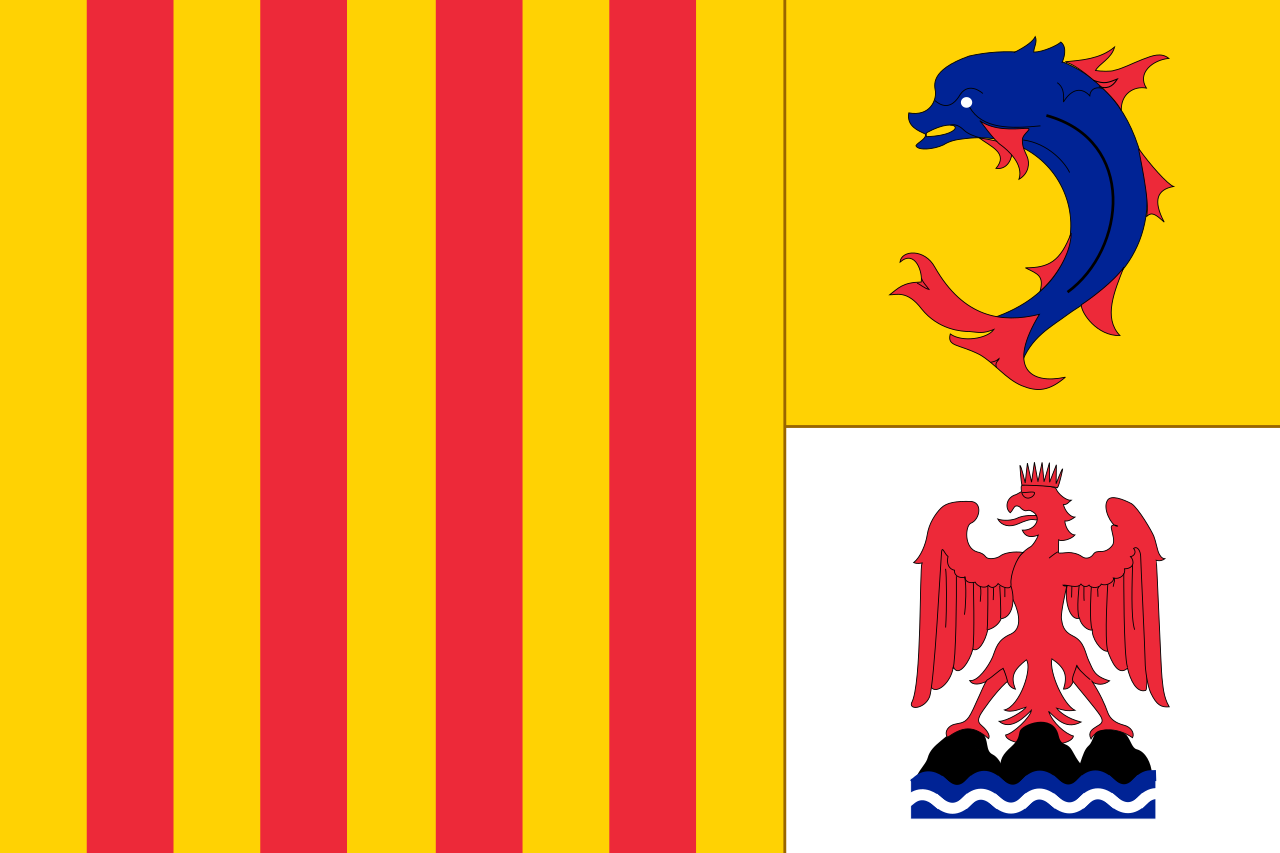 Provence-Alpes-Côte d´Azur
Provence-Alpes-Côte d´Azur

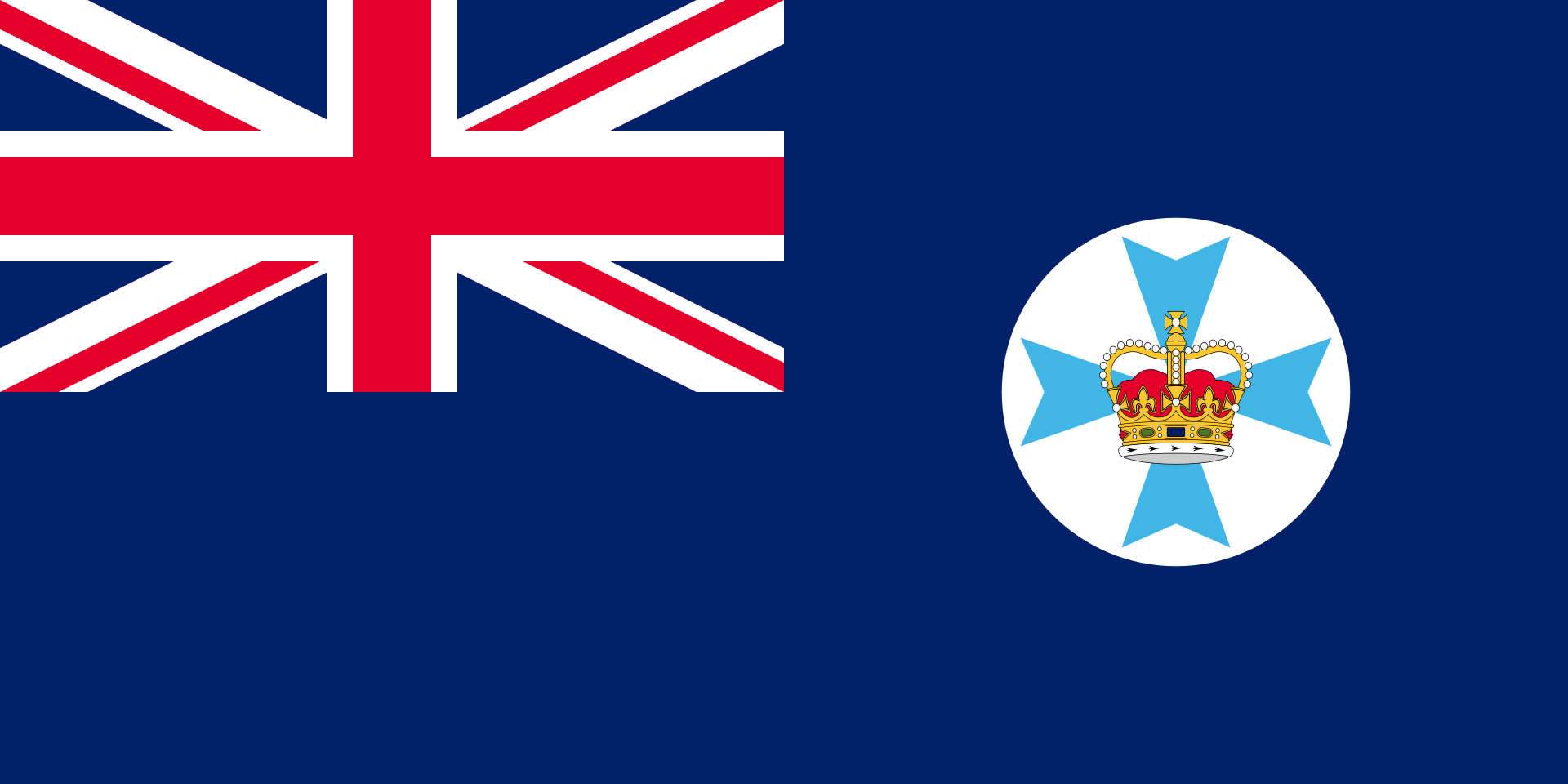 Queensland-QLD
Queensland-QLD
 Republic of Korea
Republic of Korea
 Russia
Russia
 Saudi Arabia
Saudi Arabia
 South Africa
South Africa
 Turkey
Turkey
 United States
United States
 United Kingdom
United Kingdom

 Washington, D.C.
Washington, D.C.
 Zhejiang Sheng-ZJ
Zhejiang Sheng-ZJ

Die G20 (Abkürzung für Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer) ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Sie soll als Forum für die Kooperation und Konsultation in Fragen des internationalen Finanzsystems dienen.
An den Treffen der G20 nehmen die Staats- und Regierungschefs der G20 Länder, die Finanzminister und Zentralbankchefs der G8 und elf weiterer Staaten, darunter die O-5, sowie die EU-Präsidentschaft (wenn diese zu diesem Zeitpunkt nicht von einem G8-Staat geführt wird), der Präsident der Europäischen Zentralbank, der Geschäftsführende Direktor (Managing Director) des Internationalen Währungsfonds, der Vorsitzende des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC), der Präsident der Weltbank und der Vorsitzende des Development Committees von Weltbank und Internationalem Währungsfonds teil.

 Financial
Financial

 Financial
Financial
 *Brazil economic data
*Brazil economic data

 Financial
Financial
 *China economic data
*China economic data

 Financial
Financial
 *Germany economic data
*Germany economic data

 Financial
Financial
 *European Union economic data
*European Union economic data

 Financial
Financial
 *France economic data
*France economic data

 Financial
Financial
 *India economic data
*India economic data

 Financial
Financial
 *Indonesia economic data
*Indonesia economic data

 Financial
Financial
 *Italy economic data
*Italy economic data

 Financial
Financial
 *Japan economic data
*Japan economic data

 Financial
Financial
 *Canada economic data
*Canada economic data

 Financial
Financial
 *Russia economic data
*Russia economic data

 Financial
Financial
 *United Kingdom economic data
*United Kingdom economic data

 Financial
Financial
 *United States economic data
*United States economic data
停滞性通货膨胀(英语:stagflation),简称滞脹或停滞性通脹,在经济学、特别是宏观经济学中,特指经济停滞(stagnation),失业及通货膨胀(inflation,此处指物价持续上涨)同时持续增长的经济现象。停滞性通胀(stagflation)作为混成词起源于英国政治人物麦克劳德1965年在国会的演说中。
Der Begriff Stagflation (ein Kofferwort aus den Begriffen „Stagnation“ und „Inflation“) beschreibt eine Situation eines Währungsraumes, in der wirtschaftliche Stagnation und Inflation miteinander einhergehen. Dieses Phänomen wurde in den 1970er Jahren im Zuge der Ölkrise in fast allen westlichen Volkswirtschaften beobachtet. Die Wortschöpfung Stagflation wird dem 1970 verstorbenen britischen Finanzminister Iain Macleod und John Overcountry zugeschrieben.
 *Think tanks in Germany
*Think tanks in Germany

 Berlin
Berlin

 Education and Research
Education and Research

 European Union
European Union

 Financial
Financial
 *Germany economic data
*Germany economic data

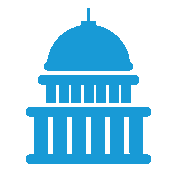 Party and government
Party and government
 *Think Tank
*Think Tank

 Economy and trade
Economy and trade
 Economic and political research
Economic and political research

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und Trägerin des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit (englisch German Institute for International and Security Affairs), das den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung sowie politische Entscheidungsträger in für Deutschland wichtigen internationalen Organisationen, vor allem in EU, NATO und den Vereinten Nationen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. internationalen Politik berät. Das Institut gehört zu den einflussreichsten deutschen Forschungseinrichtungen für außen- und sicherheitspolitische Fragen.
 Abe Shinzō
Abe Shinzō
 Alexis Tsipras
Alexis Tsipras
 Angela Merkel
Angela Merkel
 António Guterres
António Guterres
 Christine Lagarde
Christine Lagarde
 David Cameron
David Cameron
 Dilma Rousseff
Dilma Rousseff
 Dmitri Anatoljewitsch Medwedew
Dmitri Anatoljewitsch Medwedew
 Donald Trump
Donald Trump
 Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

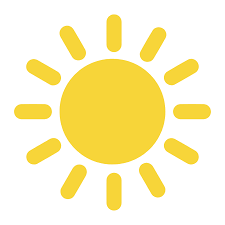 Energy resource
Energy resource
 Felipe Calderón
Felipe Calderón
 Felipe VI.
Felipe VI.

 Financial
Financial

 Hand in Hand
Hand in Hand
 Hassan Rohani
Hassan Rohani
 Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
 James Gordon Brown
James Gordon Brown
 Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker
 Jim Yong Kim
Jim Yong Kim
 Joachim Gauck
Joachim Gauck
 José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero
 Juan Manuel Santos
Juan Manuel Santos
 Li Keqiang
Li Keqiang
 Liaoning Sheng-LN
Liaoning Sheng-LN
 Mario Monti
Mario Monti
 Mark Rutte
Mark Rutte
 Mauricio Macri
Mauricio Macri
 Naoto Kan
Naoto Kan
 Narendra Modi
Narendra Modi
 Nelson Mandela
Nelson Mandela

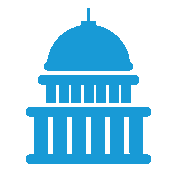 Party and government
Party and government
 *Think Tank
*Think Tank
 Paul Kagame
Paul Kagame
 Petro Poroschenko
Petro Poroschenko
 Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
 Switzerland
Switzerland
 Stephen Joseph Harper
Stephen Joseph Harper
 Tarō Asō
Tarō Asō
 Theresa May
Theresa May
 Tianjin Shi-TJ
Tianjin Shi-TJ
 Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
 Wen Jiabao
Wen Jiabao

 Economy and trade
Economy and trade
 Economic and political research
Economic and political research
 Wladimir Wladimirowitsch Putin
Wladimir Wladimirowitsch Putin
 World Economic Forum,WEF
World Economic Forum,WEF
 Klaus Schwab
Klaus Schwab
 Xi Jingping
Xi Jingping
 Yasuo Fukuda
Yasuo Fukuda

| Year | Dates | Theme |
|---|---|---|
| 1988 | The new state of the world economy | |
| 1989 | Key developments in the 90s: implications for global business | |
| 1990 | Competitive cooperation in a decade of turbulence | |
| 1991 | The new direction for global leadership | |
| 1992 | Global cooperation and megacompetition | |
| 1993 | Rallying all the forces for global recovery | |
| 1994 | Redefining the basic assumptions of the world economy | |
| 1995 | Leadership for challenges beyond growth | |
| 1996 | Sustaining globalization | |
| 1997 | Building the network society | |
| 1998 | Managing volatility and priorities for the 21st century | |
| 1999 | Responsible globality: managing the impact of globalization | |
| 2000 | New beginnings: making a difference | |
| 2001 | 25–30 January | Sustaining growth and bridging the divides: a framework for our global future |
| 2002 | 31 January – 4 February | Leadership in fragile times (held in New York instead of Davos) |
| 2003 | 21–25 January | Building trust |
| 2004 | 21–25 January | Partnering for security and prosperity |
| 2005 | 26–30 January | Taking responsibility for tough choices |
| 2006 | 25–29 January | The creative imperative[61] |
| 2007 | 24–28 January | Shaping the global agenda, the shifting power equation |
| 2008 | 23–27 January | The power of collaborative innovation |
| 2009 | 28 January – 1 February | Shaping the post-crisis world |
| 2010 | 27–30 January | Improve the state of the world: rethink, redesign, rebuild |
| 2011 | 26–30 January | Shared norms for the new reality |
| 2012 | 25–29 January | The great transformation: shaping new models |
| 2013 | 23–27 January | Resilient dynamism[62] |
| 2014 | 22–25 January | The reshaping of the world: consequences for society, politics and business |
| 2015 | 21–24 January | New global context |
| 2016 | 20–23 January | Mastering the fourth industrial revolution |
| 2017 | 17–20 January | Responsive and responsible leadership |
| 2018 | 23–26 January | Creating a shared future in a fractured world |
| 2019 | 22–25 January | Globalization 4.0: shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution |
| 2020 | 20–24 January | Stakeholders for a cohesive and sustainable world[citation needed] |
| 2021 | 17–20 August | canceled as a result of COVID-19 pandemic |
| 2022 | 22–26 May | History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies[63] |
| 2023 | 16-20 January | Cooperation in a Fragmented World [64] |
Das Weltwirtschaftsforum (englisch World Economic Forum (IPA: /ˈwɜːld ˌiːkəˈnɒmɪk ˈfɔːɹəm/), kurz WEF) ist eine in Cologny im Schweizer Kanton Genf ansässige Stiftung und Lobby-Organisation,[1] die in erster Linie für das von ihr veranstaltete Jahrestreffen gleichen Namens bekannt ist, das alljährlich in Davos im Kanton Graubünden stattfindet. Hierbei kommen zahlende Mitglieder, international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure und Journalisten zusammen, um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren.
Das Forum, das sich hauptsächlich durch seine 1000 Mitgliedsunternehmen – typischerweise globale Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als fünf Milliarden US-Dollar – sowie durch öffentliche Zuschüsse finanziert, wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet.[2] Es organisiert im Verlauf des Jahres weitere Treffen weltweit, darunter das Annual Meeting of the New Champions in China. Neben den Veranstaltungen publiziert das WEF regelmässig selbst finanzierte Forschungsberichte. Seine Mitglieder betätigen sich in branchenspezifischen Initiativen.[3]
Das WEF fordert mit Initiativen wie dem «Global Redesign»[4] und dem «Great Reset»[5] einen Multistakeholder-Governance-Ansatz,[6] um globale Entscheidungen nicht zwischenstaatlich, sondern in «Koalitionen» mit multinationalen Konzernen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu treffen.[7][8] Es sieht dabei Phasen globaler Instabilität – wie während der Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie – als Zeitfenster, seine Programmatik intensiviert voranzutreiben.[9]
Das Weltwirtschaftsforum und sein jährliches Treffen in Davos werden in folgenden Punkten kritisiert:
- Es entstünden öffentliche Kosten für Sicherheit, gleichzeitig würden hunderte Millionen Schweizer Franken an Finanzreserven gebildet und keine Bundessteuern bezahlt.
- Es handele sich um Treffen einer wohlhabenden globalen Elite ohne Bindung an die Mehrheit der Gesellschaft. Mit dem Ziel noch reicher zu werden, während es allen anderen Menschen immer schlechter geht.
- Entscheidungsprozesse seien undemokratisch.
- Es mangele an finanzieller Transparenz.
- Demokratische Strukturen und Institutionen würden vereinnahmt.
- Auswahlkriterien seien unklar.
- Der ökologische Fussabdruck seiner Jahrestagungen sei für das Klima stark belastend.
- Kritische Medien würden nicht akkreditiert.
- Viele Aktivitäten seien lediglich institutionelle Beschönigungsinitiativen.
- Globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie würden für die Durchsetzung der eigenen Programmatik vereinnahmt.
Neben Wirtschaftspolitik konzentriert sich das WEF im Rahmen seiner Agenda zunehmend auf positiv konnotierte aktivistische Themen wie Umweltschutz[10] und Soziales Unternehmertum,[11] was Kritiker als eine Strategie zur Verschleierung der wahren plutokratischen Ziele der Organisation sehen.
Organisation
Das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat seit 2015 offiziell den Status einer internationalen Organisation.[16] Es bezeichnet sich selbst als unparteiisch und an keinerlei politische oder nationale Interessen gebunden. Das WEF hat Beobachterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und steht unter der externen Aufsicht des Eidgenössischen Departement des Innern. Sein höchstes internes Aufsichtsgremium ist der Stiftungsrat. Mitglieder und Direktoren ergeben sich aus dem Eintrag im Handelsregister des Kantons Genf. Die Mission des Forums lautet, «den Zustand der Welt zu verbessern» (englisch: committed to improving the state of the world).[17]
Der Hauptsitz des Weltwirtschaftsforum ist Cologny im Schweizer Kanton Genf. Es gibt darüber hinaus Büros in Peking (China), New York (USA) und Tokio (Japan). 2016 eröffnete das Forum das «Center for the Fourth Industrial Revolution» in San Francisco (USA).[18]
Mitgliedschaft
Das typische Mitgliedsunternehmen ist ein globales Unternehmen mit einem Umsatz von über 5 Mrd. US-Dollar, wobei dies je nach Branche und Region variieren kann. Ausserdem zählen die meisten dieser Unternehmen zu den wichtigsten Unternehmen ihrer Branche und/oder ihres Landes und spielen bei der Zukunftsgestaltung ihrer Branche und/oder Region eine wichtige Rolle.[19] Seit 2005 bezahlt jedes Mitgliedsunternehmen eine Basis-Jahresmitgliedsgebühr von 42'500 Schweizer Franken (CHF) und eine Gebühr von 18'000 CHF für die Teilnahme ihres Präsidenten am Jahrestreffen in Davos. Industrie- und strategische Partner bezahlen jeweils 250'000 CHF und 500'000 CHF, um massgeblich an den Initiativen des Forums mitzuwirken.[20][21]
Für das Jahr 2019 hat Bloomberg insgesamt 436 börsennotierte Unternehmen identifiziert, die am Jahrestreffen teilgenommen haben, und dabei eine Underperformance der Davos-Teilnehmer von rund −10 % gegenüber dem S&P 500 im selben Jahr gemessen. Treiber sind u. a. eine Überrepräsentation von Finanzunternehmen und eine Unterrepräsentation von wachstumsstarken Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Informationstechnologie auf der Konferenz.[22] The Economist hatte in einer früheren Studie ähnliche Ergebnisse gefunden, die eine Underperformance der Davos-Teilnehmer gegenüber dem MSCI World Index und dem S&P 500 zwischen 2009 und 2014 zeigten.[23]
Finanzierung und staatliche Beteiligung
Das Forum wird von seinen rund 1000 Mitgliedsunternehmen sowie durch staatliche Zuschüsse finanziert.
An den Kosten der Veranstaltung ist die Schweiz mit Aufwendungen für Polizei- und Militäreinsatz beteiligt. So wurden für das Treffen im Jahr 2019 knapp elf Millionen Franken (9,5 Millionen Euro) veranschlagt. An den Polizeikosten von neun Millionen Franken – vornehmlich für Personenschutz – beteiligt sich die Stiftung mit einem Viertel. Der Grossteil entfällt auf die Öffentliche Hand, aufgeteilt auf den Bund, den Kanton Graubünden und die Gemeinde Davos. Die Armee schützt die Verkehrswege und Gebäude und überwacht den Luftraum. Bis zu 5000 Angehörige der Streitkräfte können eingesetzt werden. Die Kosten sind im regulären Verteidigungsbudget eingeplant. Eingesetzt werden zu einem grossen Teil Wehrpflichtige in ihrer jährlichen Militärdienstleistung. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 32 Millionen Franken, die ohnehin für die Übungen anfallen würden, zuzüglich etwa vier Millionen Franken für Material und Fahrzeuge. Diese Kosten trägt der Bund.[24]
Nach Kritik aus Politik und Zivilgesellschaft zur Finanzierung der Sicherheitsmassnahmen, gab das WEF 2021 bekannt, ihre Beteiligung an der Finanzierung zu erhöhen. Dadurch sinken die Kosten für den Bund von 3,675 Millionen Franken auf 2,55 Millionen Franken pro Jahr für die Jahrestreffen 2022, 2023 und 2024.[25]
Sicherheitsmassnahmen und ihre Kosten
In Davos gibt es während des WEF einige Einschränkungen. Über das Aufgebot der Polizei und der Schweizer Armee (2005 standen etwa 5500 Soldaten im Einsatz) wird regelmässig berichtet.[26] Auch auf österreichischer Seite der Grenze wird die Luftraumsicherung[27] für das Treffen im Rahmen der Operation Dädalus des Österreichischen Bundesheers gewährleistet.
Die Gewährleistung der Sicherheit des Forums kostet die Schweiz jährlich mehrere Millionen Franken. Die Kosten der Sicherheitsmassnahmen, die vom Forum und von den Schweizer Kantonal- und Bundesbehörden gemeinsam getragen werden, werden in der Schweiz und den Schweizer Medien auch häufig kritisiert[28] und sind auch Gegenstand politischer Auseinandersetzungen.[29]
Im Februar 2021 hat der Bundesrat eine Botschaft zuhanden des Parlaments verabschiedet, bei welcher der Kanton Graubünden für die Jahre 2022–2024 mit einem Beitrag von maximal 2,55 Millionen Franken pro Jahr für die Sicherheitskosten unterstützt werden soll.[30]