
Deutsche Enzyklopädie
 Vacation and Travel
Vacation and Travel

 Eurovision Song Contest,ESC
Eurovision Song Contest,ESC
 ITU World Championship Series
ITU World Championship Series
 Switzerland
Switzerland
 Lausanne
Lausanne
 Silk road
Silk road

 Sport
Sport
 Triathlon
Triathlon

 Vacation and Travel
Vacation and Travel

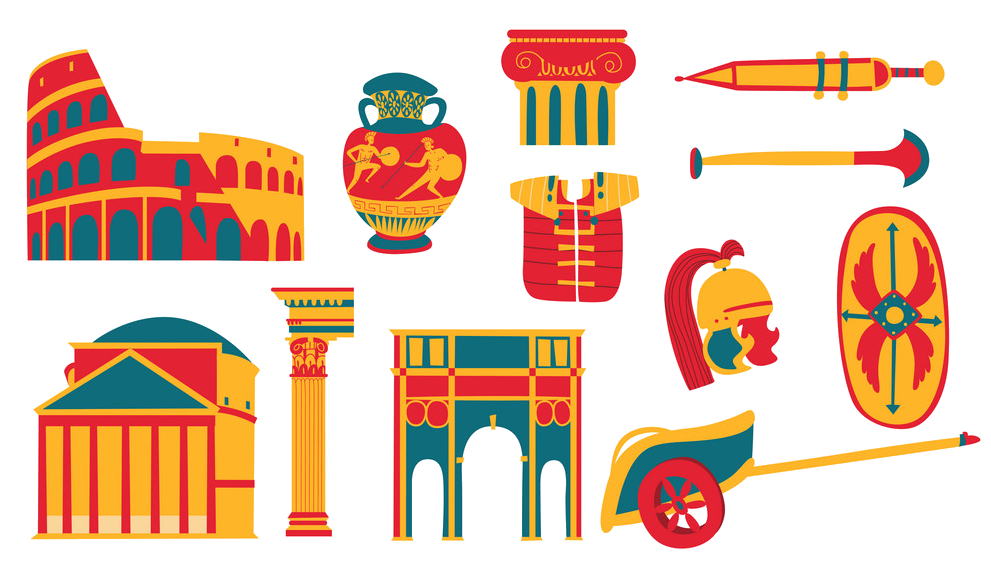 Cities founded by the Romans
Cities founded by the Romans

Lausanne [lɔˈzan] (deutsch veraltet auch Lausannen und Losanen,[4] frankoprovenzalisch Losena [lɔˈzəna],[5] italienisch und rätoromanisch Losanna) ist eine politische Gemeinde, der Hauptort des Schweizer Kantons Waadt und die Hauptstadt des Distrikts Lausanne. Die Stadt liegt in der französischsprachigen Schweiz (Romandie), am Genfersee und gehört mit ihren 144'000 Einwohnern[2] (Februar 2017) – neben Zürich, Genf, Basel, Bern und Winterthur – zu den grössten politischen Gemeinden der Schweiz.
Lausanne ist Teil der Metropolregion Genf-Lausanne mit 1,2 Millionen Einwohnern und ein bedeutendes Wirtschafts-, Kultur- und Bildungszentrum sowie eine wichtige Verkehrsdrehscheibe in der Westschweiz. Mit 43 Prozent Ausländern[2] (Einwohner ohne Bürgerrecht) zählt Lausanne, unter anderem neben Genf,[6] zu den Schweizer Städten mit hohem Ausländeranteil.
Das Bundesgericht (BGer) hat in Lausanne seinen Sitz, ebenso der Internationale Sportgerichtshof (TAS) und das Schweizer Filmarchiv. Zudem haben in Lausanne verschiedene Sportweltverbände, darunter das Internationale Olympische Komitee (IOC), ihren Hauptsitz. Seit 1994 trägt die Stadt den offiziellen Titel als «Olympische Hauptstadt».

Leipzig ([ˈlaɪ̯pt͡sɪç]; Mundart Leibzsch)[2] ist eine kreisfreie Stadt sowie mit 591.686 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2018)[3] die größte Stadt im Freistaat Sachsen. In der Liste der Großstädte in Deutschland nimmt sie nach Bevölkerung den zehnten Rang ein (Stand: 31. Dezember 2017). Für Mitteldeutschland ist sie ein historisches Zentrum der Wirtschaft, des Handels und Verkehrs, der Verwaltung, Kultur und Bildung sowie für die „Kreativszene“.[4]
Leipzig ist eines der sechs Oberzentren Sachsens und bildet mit der rund 32 Kilometer entfernten Großstadt Halle (Saale) im Land Sachsen-Anhalt den Ballungsraum Leipzig-Halle, in dem etwa 1,1 Millionen Menschen leben. Mit Halle und weiteren Städten in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist Leipzig Teil der polyzentralen Metropolregion Mitteldeutschland.[5]
Nach Verleihung des Stadtrechts und der Marktprivilegien um das Jahr 1165 entwickelte sich Leipzig bereits während der deutschen Ostsiedlung zu einem wichtigen Handelszentrum. Leipzigs Tradition als bedeutender Messestandort in Mitteleuropa mit einer der ältesten Messen der Welt geht auf das Jahr 1190 zurück und war eng mit der langjährigen Rolle Leipzigs als internationales Zentrum des Pelzhandels verknüpft. In der Zeit des Nationalsozialismus trug Leipzig von 1937 bis 1945 offiziell den Stadt-Ehrentitel Reichsmessestadt.[6] Die Stadt ist ein historisches Zentrum des Buchdrucks und -handels. Außerdem befinden sich in Leipzig eine der ältesten Universitäten sowie die ältesten Hochschulen sowohl für Handel als auch für Musik in Deutschland. Leipzig verfügt über eine große musikalische Tradition, die vor allem auf das Wirken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy zurückgeht und sich heute unter anderem auf die Bedeutung des Gewandhausorchesters und des Thomanerchors stützt.
Im Zuge der Montagsdemonstrationen 1989, die einen entscheidenden Impuls für die Wende in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) gaben, wurde Leipzig als Heldenstadt bezeichnet.[7] Die informelle Auszeichnung für den so mutigen wie friedlichen Einsatz vieler Leipziger Bürger im Umfeld der Leipziger Nikolaikirche prägte den Ruf der Stadt[8] nach der Wende und wird beim Stadtmarketing unter dem Motto „Leipziger Freiheit“ aufgegriffen. Darüber hinaus ist Leipzig für seinen Reichtum an aufwändig sanierten bzw. rekonstruierten Kulturdenkmalen und städtischen Kanälen, den artenreichen Zoo sowie das durch Rekultivierung ehemaliger Braunkohletagebaue entstehende Leipziger Neuseenland bekannt.

Die Hansestadt Lübeck[2] ( Anhören?/i) (niederdeutsch: Lübęk, Lübeek; Adjektiv: lübsch, lübisch, spätestens seit dem 19. Jahrhundert auch lübeckisch), lateinisch Lubeca, ist eine kreisfreie Großstadt im Norden Deutschlands und im Südosten Schleswig-Holsteins an der Ostsee (Lübecker Bucht). Mit etwa 220.000 Einwohnern[3] ist Lübeck nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern und eines der vier Oberzentren und eine Regiopole des Landes. Lübeck ist mit rund 214 km² die flächenmäßig größte Stadt Schleswig-Holsteins. Die nächstgelegenen großen Städte sind Hamburg etwa 65 Kilometer südwestlich, Kiel etwa 78 Kilometer nordwestlich und Schwerin etwa 68 Kilometer südöstlich. Lübeck gehört der europäischen Metropolregion Hamburg an.
Anhören?/i) (niederdeutsch: Lübęk, Lübeek; Adjektiv: lübsch, lübisch, spätestens seit dem 19. Jahrhundert auch lübeckisch), lateinisch Lubeca, ist eine kreisfreie Großstadt im Norden Deutschlands und im Südosten Schleswig-Holsteins an der Ostsee (Lübecker Bucht). Mit etwa 220.000 Einwohnern[3] ist Lübeck nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern und eines der vier Oberzentren und eine Regiopole des Landes. Lübeck ist mit rund 214 km² die flächenmäßig größte Stadt Schleswig-Holsteins. Die nächstgelegenen großen Städte sind Hamburg etwa 65 Kilometer südwestlich, Kiel etwa 78 Kilometer nordwestlich und Schwerin etwa 68 Kilometer südöstlich. Lübeck gehört der europäischen Metropolregion Hamburg an.
Die Hansestadt erhielt 1160 das Stadtrecht und wird auch „Stadt der Sieben Türme“ und „Tor zum Norden“ genannt. Sie gilt als „Königin“ und „Mutter der Hanse“, einer Handelsvereinigung, die seit dem 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit durch Freihandel und friedliche Zusammenarbeit für großen Wohlstand in Lübeck und anderen Mitgliedsstädten sorgte. St. Marien zu Lübeck gilt als eines der Hauptwerke und als „Mutterkirche“ der Backsteingotik, die vom Wendischen Städtebund aus Verbreitung im nordeuropäischen Raum fand. Die mittelalterliche Lübecker Altstadt mit zahlreichen Kulturdenkmalen ist seit 1987 Teil des UNESCO-Welterbes. Lübeck hatte eine seit 1226 bestehende Tradition als Freie Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich und als Freie Stadt bzw. Stadtstaat, diese endete im Jahr 1937 mit dem Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen.

 Architecture
Architecture
 Gothic architecture
Gothic architecture
 Germany
Germany

 History
History
 L 1000 - 1500 AD
L 1000 - 1500 AD

 Religion
Religion

 Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein

 Vacation and Travel
Vacation and Travel

 World Heritage
World Heritage

Der Lübecker Dom (auch Dom zu Lübeck) ist der erste große Backsteinkirchbau an der Ostsee und mit fast 132 Metern Länge eine der längsten Backsteinkirchen. 1173 wurde der Lübecker Dom von Heinrich dem Löwen begründet und 1247 geweiht. Patrone der evangelischen Kirche sind die Heiligen Johannes der Täufer und Blasius (wie im Braunschweiger Dom), Maria und Nikolaus.
Im Jahre 1173 legte Heinrich der Löwe als Stifter den Grundstein des Domes als Kathedrale für das Bistum Lübeck, nachdem im Jahre 1160 das Domkapitel und der Bischofssitz von Oldenburg in Holstein unter Bischof Gerold hierher verlegt worden war. Der Lübecker Dom gehört somit zu den vier sogenannten Löwendomen (Ratzeburg 1154, Schwerin 1171, Braunschweig 1173). Die Kirche wurde als Bischofskirche Johannes dem Täufer und als Gemeindekirche dem Heiligen Nikolaus geweiht.
Vorgängerkirche des Doms war eine provisorische Holzkirche und die in Richtung Trave vor dem Dom gelegene erste Kirche Lübecks, St. Johann auf dem Sande, die sich etwa an der Stelle des heutigen Bauhofs befand. Diese Kirche wurde 1150 von Vizelin geweiht, genügte aber nach der Verlegung des Bistums von Oldenburg (Holstein) nach Lübeck den Anforderungen der Bischöfe und der wachsenden Stadt nicht mehr, weswegen 1173 der Entschluss zum Dombau in unmittelbarer Nähe gefasst wurde. Der Giebel von St. Johann a.d.S. stürzte 1648 ein, vier Jahre später wurde die Kirche völlig abgetragen.[1]
Die romanische Basilika wurde 1247 fertiggestellt und geweiht. Um 1254 wurde am nördlichen Querhaus eine Eingangsvorhalle angebaut, das Paradies. Anschließend wurde der romanische Dom ab 1266 zu einer gotischen Hallenkirche umgebaut, indem man die beiden Seitenschiffe etwa auf die Höhe des Mittelschiffes auf rund 21 Meter anhob. Ebenfalls in dieser Zeit erfolgte die Verlängerung des Baukörpers durch die Errichtung des gotischen Chores unter Bischof Heinrich II. Bochholt (1317–1341). Dieser wandte einen Betrag von 28.000 Mark[2] für den 1341 fertiggestellten Chor auf, in dessen Mitte er auch unter einer bemerkenswerten Grabplatte aus Messing begraben liegt, die dem Erzgießer Hans Apengeter zugeschrieben wird.
1341 war der romanisch-gotische Lübecker Dom in seiner heutigen Gestalt vollendet. Der Baukörper wurde dadurch auf rund 132 m verlängert, und die romanische Apsis wurde nach Fertigstellung des gotischen Chors bis auf die Fundamente abgerissen.
Der Unterschied zwischen den beiden Bauabschnitten ist auch für Laien in der Kirche deutlich erkennbar: Der ältere Bauteil romanischer Zeit wird von massiven, rechteckigen Pfeilern getragen, der jüngere gotische Chor von schlankeren, runden Säulen. Dieser Übergang wird seit der Nachkriegs-Rekonstruktion in den 1970er Jahren durch eine Glaswand markiert. Insbesondere die Türme zeigen noch deutlich die Formen der Romanik.
Bis zur Reformation unterstand das Domkapitel dem Bischof und nicht dem Rat der Stadt. Im Zuge der Reformation wurde der Dom bis 1803 gemeinschaftliches Eigentum von Stadt und Domkapitel und ging dann mit Auflösung des Domkapitels in das Alleineigentum der Stadt über. Das Domkloster Lübeck wurde Ende des 19. Jahrhunderts Museumsstandort des Museums am Dom.
Der erhaltene mittelalterliche Kreuzgang an der Südseite der Kirche verbindet den Dom heute mit dem Baukörper des Museums für Natur und Umwelt und des Archivs der Hansestadt Lübeck.
Der Dom wurde im Laufe der Jahrhunderte häufiger aufgrund seiner freien Lage am Wasser zwischen Obertrave und Mühlenteich durch Wetter und Stürme beschädigt. 1611 musste der nördliche Turmhelm ersetzt werden, 1648 wurde ein „Knopf nebst Wetterhahn in den Mühlenteich geschleudert“, und um 1766 wurden die kleinen Nebentürme beseitigt.

Die Hansestadt Lüneburg (niederdeutsch Lünborg, Lümborg, englisch [veraltet] Lunenburg, lateinisch Luneburgum oder Lunaburgum, altsächsisch Hliuni, polabisch Glain) ist eine große Mittelstadt im Nordosten von Niedersachsen und eines von neun Oberzentren des Bundeslandes. Die Stadt an der Ilmenau liegt ungefähr 50 Kilometer südöstlich von Hamburg am Rande der Lüneburger Heide und gehört zur Metropolregion Hamburg. Lüneburg liegt nur etwa 15 Kilometer südlich der Landesgrenzen zu Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Lüneburg liegt am Unterlauf der schiffbaren Ilmenau, etwa 30 km vor ihrem Zusammenfluss mit der Elbe. Südlich und westlich erstreckt sich die Lüneburger Heide, eine etwa 7400 km² große Fläche, die seit der Jungsteinzeit durch Brandrodung und Überweidung der ehemals weit verbreiteten Wälder auf unfruchtbaren Sandböden und den Einschlag großer Mengen von Holz entwaldet wurde. Die vielfach zitierte Aussage, die Heide sei durch Holzeinschlag für den Betrieb der Saline Lüneburg entstanden, ist historisch nicht gesichert. Die Lüneburger Altstadt liegt zudem über einem Salzstock, der den Reichtum der Stadt begründete und dessen Kappe aus Gips, der Kalkberg, zugleich einen hervorragenden Bauplatz für die Fluchtburg darstellte, die Lüneburg ihren Namen gab.
Der befestigte Betriebsweg am Kanal ist für Fußgänger und Radfahrer freigegeben und ermöglicht beidseitig nahezu auf voller Länge steigungsfreie Radtouren in nächster Nähe zu den Schiffen. Das Übersetzen auf die jeweils andere Kanalseite mit einer der zahlreichen Fähren ist kostenlos. Dies hatte bereits Kaiser Wilhelm in einer Anordnung verfügen lassen, um eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, da die künstliche Wasserstraße ältere Verkehrswege durchschneidet. Die Radwege am Nord-Ostsee-Kanal sind Teil der im Mai 2004 eröffneten Deutschen Fährstraße, einer rund 250 Kilometer langen Ferienstraße, die von Bremervörde an der Oste bis Kiel führt.
In Hochdonn und Hohenhörn gibt es Campingplätze am Kanal.[94][95] An einigen Kanalfähren und in unmittelbarer Nähe zur Kieler Schleuse sind Stellplätze für Wohnmobile vorhanden. Nahe dem Hochdonner Campingplatz liegt die öffentliche Badestelle Klein Westerland. Sie wird von der Gemeinde Hochdonn unterhalten und ist die einzige Badestelle am Nord-Ostsee-Kanal.
Die Schleusenanlagen in Brunsbüttel und Kiel können, ebenso wie das dort jeweils befindliche Schleusenmuseum, ganzjährig besichtigt werden. Für den Bau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel – Deutschlands größter Wasserbaustelle – werden Führungen durch die örtliche Volkshochschule angeboten.
Je ein Rastplatz bei der Autobahnbrücke der A 23 (nordwärts, vor dem Kanal) sowie zwischen den Anschlussstellen 8 und 9 der A 7 ermöglichen einen Ausblick auf den Kanal.
Seit dem 2. Juni 1997 gibt es die Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg. Dort wird jedes Schiff durch Dippen der Flagge und mit der jeweiligen Nationalhymne unter der Eisenbahnhochbrücke begrüßt.

Magdeburg (ˈmakdəˌbʊʁk  Aussprache?/i, niederdeutsch Meideborg) ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stadt an der Elbe ist eines der drei Oberzentren und ist mit 238.478 Einwohnern (Statistisches Landesamt Stand 31. Dezember 2017[2]) die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts und die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer. Magdeburg stand 2016 auf der Liste der Großstädte in Deutschland auf Platz 31.
Aussprache?/i, niederdeutsch Meideborg) ist die Hauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Die Stadt an der Elbe ist eines der drei Oberzentren und ist mit 238.478 Einwohnern (Statistisches Landesamt Stand 31. Dezember 2017[2]) die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts und die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer. Magdeburg stand 2016 auf der Liste der Großstädte in Deutschland auf Platz 31.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt im Jahr 805. 968 wurde durch Otto I., erster Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (und zusammen mit Otto von Guericke Namenspatron der heutigen „Ottostadt Magdeburg“) das Erzbistum Magdeburg begründet. Im Mittelalter erlangte die Hansestadt große Bedeutung durch den Freihandel und das Magdeburger Stadtrecht. Sie war im Spätmittelalter eine der größten deutschen Städte und Zentrum der Reformation und des Widerstandes gegen die Rekatholisierung im Schmalkaldischen Bund. Nach der fast völligen Verwüstung im Dreißigjährigen Krieg wurde Magdeburg zur stärksten Festung des Königreichs Preußen ausgebaut.
Im Jahr 1882 wurde Magdeburg mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt erneut schwer getroffen: Nach dem Luftangriff am 16. Januar 1945 waren 90 % der dichtbesiedelten Altstadt, 15 Kirchen und weite Teile der Gründerzeitviertel stark zerstört. Zu DDR-Zeiten wurden mehrere kriegsbeschädigte beziehungsweise -zerstörte Bauwerke abgerissen, darunter 1956 die Ulrichskirche. Von 1952 bis 1990 war Magdeburg DDR-Bezirksstadt, seit 1990 ist sie Landeshauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt.
Die Stadt am Schnittpunkt von Elbe, Elbe-Havel- und Mittellandkanal besitzt einen bedeutenden Binnenhafen und ist ein Industrie- und Handelszentrum. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind der Maschinen- und Anlagenbau, Gesundheitswirtschaft, Umwelttechnologien und Kreislaufwirtschaft, Logistik sowie die Herstellung von chemischen Produkten, Eisen- und Stahlerzeugnissen, Papier und Textilien.
Magdeburg ist sowohl evangelischer als auch katholischer Bischofssitz. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Magdeburger Dom.
In der Landeshauptstadt befinden sich zahlreiche bedeutende Kultureinrichtungen, darunter das Theater Magdeburg und das Kulturhistorische Museum Magdeburg. Magdeburg ist zudem Standort der Otto-von-Guericke-Universität sowie der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Die Universitätsstadt Mannheim (kurpfälzisch Mannem [manəm],[2] auch Monnem) ist ein Stadtkreis mit 309.817[3] Einwohnern (31. Dezember 2020) im Regierungsbezirk Karlsruhe in Baden-Württemberg. Sie ist nach Stuttgart und vor Karlsruhe die zweitgrößte Stadt des Landes.[4] Die ehemalige Residenzstadt (1720–1778) der Kurpfalz mit ihrem stadtprägenden Barockschloss, einer der größten Schlossanlagen der Welt, bildet das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar mit 2,35 Millionen Einwohnern.
Mannheim liegt unmittelbar im Dreiländereck mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Von seiner rheinland-pfälzischen Schwesterstadt Ludwigshafen am Rhein, mit der es ein zusammenhängendes Stadtgebiet bildet, ist Mannheim durch den Rhein getrennt.
Erstmals 766 im Lorscher Codex urkundlich erwähnt, erhielt Mannheim 1607 die Stadtprivilegien, nachdem Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz den Grundstein zum Bau der Festung Friedrichsburg gelegt hatte. Das damals für die mit der Festung verbundene Bürgerstadt Mannheim angelegte gitterförmige Straßennetz mit Häuserblöcken statt Straßenzügen ist in der Innenstadt erhalten geblieben. Darauf ist die Bezeichnung Quadratestadt zurückzuführen.
Seit 1896 Großstadt, ist Mannheim heute eine bedeutende Industrie- und Handelsstadt, Universitätsstadt und wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart, unter anderem mit einem ICE-Knotenpunkt, dem zweitgrößten Rangierbahnhof Deutschlands und einem der bedeutendsten Binnenhäfen Europas.
Mit dem als Schillerbühne bekannten Nationaltheater Mannheim, der Kunsthalle Mannheim, den Reiss-Engelhorn-Museen und dem Technoseum ist Mannheim ein überregional bedeutender Theater- und Museumsstandort. Die Popakademie Baden-Württemberg und eine lebendige Musikszene machen Mannheim auch zu einem wichtigen Zentrum der deutschen Popmusik, seit 2014 ist Mannheim UNESCO City of Music. Sie ist zugleich eine moderne Fortführung der Mannheimer Schule, die schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts viele Musiker (u. a. Wolfgang Amadeus Mozart) nach Mannheim führte und die damalige Musikszene bereicherte.
Bekannt ist Mannheim auch für seine Universität, welche zu den besten Wirtschaftsuniversitäten Deutschlands zählt und insbesondere im Fach Betriebswirtschaftslehre immer wieder Bestnoten erhält. Des Weiteren sind in Mannheim eine Hochschule, die Hochschule des Bundes mit seinem Fachbereich Bundeswehrverwaltung, eine Musikhochschule, eine Duale Hochschule, eine Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und eine Medizinfakultät der Universität Heidelberg angesiedelt.
Mannheim liegt an der Burgenstraße, ist Start- und Zielort der Bertha Benz Memorial Route und Teil der Straße der Demokratie.
Mannheim liegt im nördlichen Oberrheingebiet an der Mündung des Neckars in den Rhein. Die Stadtteile verteilen sich auf der rechten Rheinseite zu beiden Seiten des Neckars.
Die Stadt liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar, einem 2,35 Millionen Einwohner zählenden Verdichtungsgebiet, das neben Teilen Südhessens und der rheinland-pfälzischen Vorderpfalz in Baden-Württemberg die beiden Stadtkreise Mannheim und Heidelberg sowie die westlichen und südlichen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises umfasst.
Innerhalb der Region Rhein-Neckar bildet Mannheim neben Heidelberg ein Oberzentrum, von denen für ganz Baden-Württemberg nach dem Landesentwicklungsplan 2002 insgesamt 14 ausgewiesen sind. Das Oberzentrum Mannheim übernimmt für die Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Ilvesheim und Ladenburg die Funktion eines Mittelbereichs. Ferner gibt es Verflechtungen mit Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz und den dortigen Mittelbereichen.
Nächste größere Städte sind Frankfurt am Main, etwa 70 Kilometer nördlich, Karlsruhe, etwa 50 Kilometer südwestlich und Stuttgart, etwa 95 Kilometer südöstlich.
Durch die Lage direkt an der baden-württembergischen Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und Hessen ist Mannheim neben dem Stadtstaat Hamburg die einzige Großstadt in Deutschland, die direkt an zwei Länder grenzt.

 Bavaria
Bavaria
 Germany
Germany
 Eurovision Song Contest,ESC
Eurovision Song Contest,ESC
 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006
 UEFA European Championship 2020
UEFA European Championship 2020

 History
History
 M 1500 - 2000 AD
M 1500 - 2000 AD

 History
History
 L 1000 - 1500 AD
L 1000 - 1500 AD

 History
History
 N 2000 - 2100 AD
N 2000 - 2100 AD

 International cities
International cities
 ***Global Urban Economic Competitiveness
***Global Urban Economic Competitiveness
 Olympic Summer Games
Olympic Summer Games
 1972 Summer Olympics
1972 Summer Olympics
 Silk road
Silk road

 Vacation and Travel
Vacation and Travel

München (hochdeutsch  [ˈmʏnçn̩] oder [ˈmʏnçən̩];[4] bairisch
[ˈmʏnçn̩] oder [ˈmʏnçən̩];[4] bairisch  Minga?/i [ˈmɪŋ(:)ɐ]) ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Sie ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt Bayerns und (nach Berlin und Hamburg) die nach Einwohnern drittgrößte Gemeinde Deutschlands sowie die viertgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und zwölftgrößte der Europäischen Union. Im Ballungsraum München leben mehr als 2,9 Millionen Menschen,[5][6] die flächengrößere europäische Metropolregion München umfasst rund 5,7 Millionen Einwohner.
Minga?/i [ˈmɪŋ(:)ɐ]) ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Sie ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt Bayerns und (nach Berlin und Hamburg) die nach Einwohnern drittgrößte Gemeinde Deutschlands sowie die viertgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und zwölftgrößte der Europäischen Union. Im Ballungsraum München leben mehr als 2,9 Millionen Menschen,[5][6] die flächengrößere europäische Metropolregion München umfasst rund 5,7 Millionen Einwohner.
Die Landeshauptstadt ist eine kreisfreie Stadt und bayerische Metropole,[7] zudem Verwaltungssitz des die Stadt umgebenden gleichnamigen Landkreises mit dem Landratsamt München als Verwaltung, des Bezirks Oberbayern und des Regierungsbezirks Oberbayern.
München wird zu den Weltstädten gezählt.[8] Die Metropole ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Europas. Sie ist Sitz zahlreicher Konzerne, darunter fünf DAX-Unternehmen (Allianz, BMW, Linde, Munich Re, Siemens). Hier befindet sich die einzige Börse Bayerns. In der Städteplatzierung des Beratungsunternehmens Mercer belegte München im Jahr 2018 unter 231 Großstädten weltweit den dritten Platz nach Lebensqualität.[9] Laut dem Magazin Monocle war es 2018 sogar die lebenswerteste Stadt der Welt.[10] Andererseits wird die Lebensqualität zunehmend durch Agglomerationsnachteile, wie Verkehrs- und Umweltbelastung sowie sehr hohe Wohneigentumspreise und Mieten[11][12] eingeschränkt, weshalb auch die Wohnfläche pro Einwohner weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt.[13] München gilt als sicherste Kommune unter den deutschen Großstädten über 200.000 Einwohnern hinsichtlich der Kriminalitätsrate aller Straftaten.[14]
München wurde 1158 erstmals urkundlich erwähnt.[15] Die Stadt wurde 1255 bayerischer Herzogssitz, war von 1328 bis 1347 kaiserliche Residenzstadt und wurde 1506 alleinige Hauptstadt Bayerns. München ist Sitz zahlreicher nationaler und internationaler Behörden sowie wichtiger Universitäten und Hochschulen, bedeutender Museen und Theater. Durch eine große Anzahl sehenswerter Bauten samt geschützten Baudenkmälern und Ensembles, internationaler Sportveranstaltungen, Messen und Kongresse sowie das weltbekannte Oktoberfest ist München ein Anziehungspunkt für den internationalen Tourismus.

 Architecture
Architecture

 Architecture
Architecture
 Neoclassic architecture *
Neoclassic architecture *

 Architecture
Architecture
 Baroque / Rococo architecture
Baroque / Rococo architecture

 Bavaria
Bavaria
 Germany
Germany

 Vacation and Travel
Vacation and Travel

Die Münchner Residenz ist ein Baudenkmal im Bezirk Altstadt-Lehel der bayerischen Landeshauptstadt München. Sie war von 1508 bis 1918 Sitz der Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern aus dem Haus Wittelsbach. In vier Jahrhunderten wurde sie von den Architekten Friedrich Sustris, Joseph Effner, François de Cuvilliés d. Ä. und Leo von Klenze in den Stilen Renaissance, Barock, Rokoko und Klassizismus von der kleinen Wehrburg zur monumentalen Vierflügelanlage ausgebaut. Sie besteht aus dem Festsaalbau an der Hofgartenstraße, dem Apothekenbau am Marstallplatz, dem Königsbau am Max-Joseph-Platz und dem Maximiliansbau an der Residenzstraße. Neben dem Cuvilliés-Theater und der Allerheiligen-Hofkirche gehören auch der Hofgarten und der Marstall zum Bauensemble, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach unter der Leitung von Otto Meitinger wiederaufgebaut wurde. Die Münchner Residenz ist mit mehr als 40.000 Quadratmetern Grundfläche das größte Stadtschloss Deutschlands und mit mehr als 150 Schauräumen eines der bedeutendsten Schlossmuseen Europas.
Gotische Neue Veste
Der Ort der Residenz war schon vor Jahrtausenden von Menschen belebt. Im Jahr 2014 fanden Archäologen direkt unterhalb des Apothekenhofes der Residenz ein fast unversehrtes, spätbronzezeitliches Grab.[2]
An der Stelle der heutigen Residenz befand sich 1385 die Neuveste, die nach Aufständen der Münchner Bürgerschaft gegen die in der Stadt residierenden Brüder Johann II., Stephan III. und Friedrich zunächst anstelle des zu unsicher gewordenen Alten Hofs als reine Fluchtburg für den Herzog und seinen Hofstaat diente. Es wird davon ausgegangen, dass bereits um 1363 mit dem Bau begonnen wurde, nachdem die Stadt im Zuge der Vollendung des Zweiten Mauerrings den Alten Hof immer mehr eingeschlossen hatte. Als Sühne für den gescheiterten Bürgeraufstand von 1385 hatten die Herzöge von der Stadt die Erlaubnis erhalten, „ein vest in die statt ze pawen und ein aigen tor … das sy aus und ein reitten“. Am 7. März 1389 wurde die Neue Veste dann auch in Bezug auf Stephan III. urkundlich erwähnt als „Newnueft zu Munichen“.
Die Neuveste war eine gotische Wasserburg, die von der Stadt her nur über eine befestigte Brücke zu erreichen war. Bezeichnenderweise lag der größte Turm, der Silberturm, nicht an der Außenseite, sondern verstärkte die Innenfront gegen die Stadt. Hier befand sich später der Staatsschatz. Nördlich des Silberturms, der auch als Bergfried diente, lag durch eine Wehrmauer getrennt an der Nordwestseite der Palas. Östlich schlossen sich im Norden des Innenhofes die Hofhalle und die Dürnitz an. Im Rahmen des Baus der Neuveste wurde Ende des 14. Jahrhunderts in der Nordostecke des zweiten Mauerrings auch das Neuvesttor errichtet. Die Neuveste wurde im Laufe der Jahrhunderte verändert und erweitert. Um 1470 wurden unter Herzog Johanns Urenkel Albrecht IV. (reg. 1465–1508) die Zwingermauern und der Torbau im Norden errichtet, 1460–1500 folgte der Bau von zwei Geschütztürmen. Noch 1466 hatte jedoch die Münchener Bürgerschaft die Kraft gehabt den Zugang von Herzog Siegmund und seines jüngeren Bruders Albrecht zur Burg zu begrenzen, wonach der erstere die Neuveste nur mit sechs, der andere mit vier Dienern betreten sollte. Albrecht drängte in der Folge das Bürgertum immer weiter zurück, seit Beginn der Neuzeit bestimmte dann der Hof die Geschicke der Stadt. 1470/71 war Albrechts Bruder Christoph der Starke in der Neuveste interniert. 1476 wurde die Neuveste nach endgültiger Aussöhnung des Herzogs mit der Bürgerschaft in die bis dahin offene Flanke der Stadtbefestigung mit einbezogen. Neuer Wohnraum wurde unter Albrecht noch nicht geschaffen. Mit der Zeit verlor die Burg allmählich ihren fortifikatorischen Charakter, der durch das verstärkte Aufkommen von Kanonen, welche die Mauern durchschlagen konnten, hinfällig geworden war. Als herzoglichen Sitz löste die Neuveste den Alten Hof allerdings erst unter Albrechts Sohn Wilhelm IV. ab. Um 1620 erfolgte dann der Abbruch aller Gebäude an der Westseite, 1750 wurden Gebäudeteile nach einem Brand notdürftig instand gesetzt, bevor erst nach 1800 die letzten Reste abgebrochen wurden.
Noch heute befinden sich jedoch unter dem Apothekenhof der Münchner Residenz die Kellergewölbe und Grundmauern der ehemaligen Burg. Ihre Position ist durch rote Steine im Pflaster des Hofes markiert. Die Mauern des südwestlichen Eckturms aus der Zeit um 1500 und die Gewölbe mit den Rundpfeilern im Ballsaalkeller im Süden der ehemaligen Burg sind die letzten erhaltenen Reste der Neuveste und der älteste Teil der heutigen Residenz.
Renaissanceschloss
Anfänge der heutigen Residenz
Als Herzog Wilhelm IV. (reg. 1508–1550) den Wohnsitz der Wittelsbacher vom Alten Hof, der seither als Behördensitz diente, in die Neuveste verlegte, begann die Geschichte der Residenz als neuzeitlicher Palast. 1518 wurde ein Hofgraben angelegt, dort wo sich heute der Marstallplatz befindet. Wilhelm ließ zwischen 1530 und 1540 an der Südostecke der Burg den genannten Rundstubenbau ausbauen und an der Stelle des heutigen Marstallplatzes auch den ersten Hofgarten einrichten. Im Gartenpavillon wurde ein Historienzyklus aufgehängt, zu dem auch Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht gehörte. 1545 befand sich die streitbare Schwester des Herzogs Sabina von Bayern in der Neuveste wochenlang unter Arrest.
Herzog Albrecht V. (reg. 1550–1579) ließ von Wilhelm Egckl neben einem südlich der Georgskapelle an der Ostseite der Neuveste gelegenen Festsaal (St. Georgssaal), auch eine Kunstkammer im Marstallgebäude (heutiges Landesamt für Denkmalpflege) einrichten, in der viele Münchner Sammlungen ihren Ursprung haben.
Da in diesem nördlich des Alten Hofs gelegenen Bau nicht genügend Platz für die umfangreiche Skulpturensammlung war, entstand zwischen 1568 und 1571 durch Simon Zwitzel und Jacopo Strada das Antiquarium.[3] Das neue Gebäude musste außerhalb der Burganlage errichtet werden, da in der Neuveste dafür kein Platz war. Dadurch gab es der Residenz eine neue Entwicklungsrichtung vor. Das Antiquarium, das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes einnehmend, ist der größte Renaissancesaal nördlich der Alpen. Im oberen Stockwerk des neuen Gebäudes wurde die Hofbibliothek untergebracht, die den Kern der späteren Bayerischen Staatsbibliothek bildete.[4]
Ab 1560 wurde weiter nördlich auf der Fläche der heutigen Staatskanzlei ein weiterer Garten angelegt. In seiner Nordost-Ecke wurde 1565/67 ein Lusthaus mit einem Zyklus von Deckengemälden zum Thema des Silbernen Zeitalters erbaut (nur einzelne Deckengemälde erhalten).[5] 1560/70 folgte der Bau eines Ballhauses an der Südwest-Ecke der Neuveste, dessen genannter Keller erhalten aber im Allgemeinen unzugänglich ist.
1580/1581 ließ Herzog Wilhelm V. (reg. 1579–1597) an der Residenzgasse den Witwenstock für Herzogin Anna erbauen. Zwischen 1581 und 1586 entstand dann die kunsthistorisch hoch bedeutende Gartenanlage des manieristischen Grottenhofs mit dem Perseusbrunnen, Friedrich Sustris war der Architekt. Er erhielt seinen Namen nach der an der westlichen Antiquariumsfassade angelegten Brunnen- und Muschelwand.[6] Im Zuge der fortlaufenden baulichen Entwicklung entstanden beginnend mit dem Grottenhof die insgesamt zehn Innenhöfe, wobei besonders dem Brunnenhof und dem Kaiserhof als Schauplätze höfischer Empfänge, Feste und Zeremonien hohe Bedeutung zukam.
Maximilianische Residenz und Kaiserhof
Unter Herzog Maximilian I. (reg. 1597–1651), dem späteren Kurfürsten, entstand ab 1599/1600 bis etwa 1607 an der Westseite des Antiquariums die nach ihm benannte Maximilianische Residenz.[7] Man spricht stilistisch von der Epoche des Manierismus oder Spätrenaissance im Übergang zum Frühbarock.
Maximilian ging dabei von seinem bereits 1590 bis 1594 an der Residenzstraße eingerichteten Erbprinzenbau aus.[8] Der zweigeschossige Bau besaß links und rechts der dreiteiligen Durchfahrt zum Kapellenhof je drei Fensterachsen. Im rückwärtigen Bereich wurde 1594 eine Kapelle ausgestattet.
Nachdem Maximilian zuerst in die Wohnung seines Vaters in der Neuveste gezogen war, wurde ab dem Jahr 1600 der ältere Erbprinzenbau weitgehend abgebrochen und südlich des Kapellenhofes bis zum Antiquarium hin ein zweigeschossiger Bereich umgebaut und neu errichtet, der die beiden Wohnungen des Herzogs und seiner Gemahlin aufnehmen sollte.[9] Die Hauptzugänge erfolgten über den Kapellenhof, der anstelle einer Gasse (Jägergassel) baulich gefasst wurde. Am östlichen Ende des Kapellenhofs wurde der Brunnenhof auf einer regelmäßige Grundrissfigur angelegt, der zuvor als Freifläche für Turniere gedient hatte. Der Architekt war wahrscheinlich ab 1600 der örtliche Hofkünstler Hans Krumpper, der die Entwürfe für die Bauten und große Teile der Dekoration vorgab.[10] Die ehemals reiche Ausstattung an Deckengemälden schuf Peter Candid mit seiner Werkstatt.[11] Die Namen von weiteren Künstlern wie Heinrich Schön sind bekannt.
Im Inneren des umgebauten Areals entstand die doppelstöckige Hofkapelle (Rohbau 1600, Weihe 1603) mit reichen Stuckaturenschmuck, der 1614 im Gewölbe ergänzt wurde. Die Empore der Hofkapelle war der Herrscherfamilie vorbehalten. Das große Mittelbild des Hauptaltars von dem Hofmaler Hans Werl von 1601 zeigt Maria in der Glorie unter der Dreifaltigkeit. 1630 wurde die Kapelle durch einen polygonalen Chor erweitert und dessen Stuck an die ältere Ausstattung angepasst.[12] Die mit Marmor gepflasterte und reich mit Stuckmarmorintarsie (Scagliola) ausgeschmückte und 1607 fertiggestellte Reiche Kapelle diente dagegen als Privatoratorium des Herzogs.[13] Um die Hofkapelle herum entstanden im Obergeschoss die privaten Gemächer des Herzogs in Osten in Richtung Antiquarium und der Herzogin im Westen an der Residenzstraße. Es gab drei großzügige Treppenaufgänge. Auch im Erdgeschoss lagen fürstliche Wohnräume, die die „Sommerzimmer“ genannt wurden und eine Ausschmückung mit Stuck und Deckengemälden erhielten.
Um 1602 entstand im Südosten an das Antiquarium anschließend im ersten Obergeschoss der Schwarze Saal, der ein illusionistisches Deckengemälde von Hans Werl erhielt (heute rekonstruiert) und über eine gleichzeitig entstandene monumentale zweiläufige Treppe vom Brunnenhof aus zugänglich war.[14] Bis 1607 wurde die Umbauung des Brunnenhofes fortgeführt, womit ein repräsentativer Hof entstand, der an den Schmalseiten Giebelbauten erhielt, von denen einer dem Uhrturm vorgelegt ist. Dieser wurde 1612–1615 nach einem Modell von Heinrich Schön dem Älteren als verkleideter, in Fachwerkbauweise errichteter freitragender Aufbau konstruiert. In der Mitte des Brunnenhofes wurde 1610 der große Wittelsbacherbrunnen errichtet. Die von Hubert Gerhard geschaffenen und dort zusammengeführten Figuren (allegorische Darstellung der vier bayerischen Flüsse: Donau, Lech, Inn und Isar) und das Standbild Ottos von Wittelsbach waren ursprünglich für andere Projekte geschaffen worden. Damit war um 1610 die erste Bauphase unter Maximilian I. im Bereich des Grottenhofes und Brunnenhofes abgeschlossen. Es standen drei Höfe für unsterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
Ab 1612 ließ Maximilian I. große Teile der Süd- und Westtrakte der Neuveste mit dem Silberturm und dem Palas abreißen, um hier neuen Erweiterungen Platz zu schaffen. Ebenso wurden 1612 und 1613 die Privathäuser an der Schwabinger Gasse (heute: Residenzstraße) abgebrochen. Hier entstanden zwischen 1612 und 1617 nördlich der bis etwa 1610 entstandenen Maximilianischen Residenz die neuen Trakte um den einheitlich in Fresko-Technik bemalten Kaiserhof.
Vor dem Eingang zum Kaiserhof und zum Kapellenhof stehen je zwei große bronzene Löwen für die vier Herrschertugenden Klugheit, Stärke, Gerechtigkeit und Mäßigung. Jeder Löwe hält ein Schild, auf dem die jeweilige Tugend symbolhaft abgebildet ist und das an der unteren Spitze jeweils in einem kleinen Löwenkopf endet. Die Berührung der Schnauze dieser kleinen Löwenköpfe soll Glück bringen.[15]
Um den Kaiserhof zogen sich mit den Trierzimmern und den Steinzimmern, dem Kaisersaal und der Kaisertreppe großzügige Gästequartier herum, die den hohen politischen Anspruch Maximilians vorführten.[16] Die unter Leitung von Hans Krumpper und Heinrich Schön errichteten und unter von Peter Candid und seiner Werkstatt mit Gemälden dekorierten Räumlichkeiten illustrieren nicht nur das Weltbild Maximilians I., sondern sind mit ihren prächtigen Türrahmungen, Deckenfreskos und Wandteppichen auch beispielhaft für die Architektur des frühen 17. Jahrhunderts. Der Name der Steinzimmer geht auf die reiche Ausstattung mit Marmor, Stuckmarmor und Scagliola zurück. Diese Raumfolge diente als höchstrangiges Gästeappartement, das vom Kaiser und seiner Gemahlin bewohnt wurde, wenn diese in München Station machten. In den Trierzimmern logierten dann im Falle kaiserlichen Besuchs die nächsten Angehörigen der Kaiserfamilie und ranghohe Mitglieder ihres Hofstaats, ansonsten dienten die Räume als Ratszimmer. Der heute wieder hergestellte Kaisersaal mit der gleichnamigen Prunktreppe war im 17. Jahrhundert der größte und bedeutendste Festraum der Residenz. Ab 1799 mussten der Kaisersaal und der anschließende Vierschimmelsaal den sog. Hofgartenzimmern, einem neuen Wohnappartement für Kurfürst Max IV. Joseph (ab 1806 König Max I. Joseph von Bayern) weichen[17], bis beide nach dem Zweiten Weltkrieg in annähernd originalgetreuer Form rekonstruiert wurden.
Auf die Zeitgenossen machte der Residenzbau, der nun die damalige Wiener Hofburg an Ausdehnung übertraf, durchaus Eindruck, auch wenn Friedrich Nicolai dann 1781 schrieb, er hätte das Gebäude eher für eine reiche Prälatur angesehen. König Gustav II. Adolf ließ nach der Besetzung Münchens durch seine Truppen im Mai 1632 dann einen evangelischen Gottesdienst in der Residenz feiern. Gegen Ende Mai 1632 verließ Gustav Adolf bereits München und zog weiter. Der Schwedenkönig, der viel Beutegut mitführte, soll gesagt haben, stünde die Residenz auf Rädern, würde er sie nach Stockholm rollen. Die Bauten der Residenz waren nun jedenfalls so umfangreich geworden, dass sie bis ins frühe 19. Jahrhundert Maximilians Nachfolgern genügten. Sie konzentrierten sich nun im Wesentlichen auf den Innenausbau der Residenz.
Barocke Residenz
Appartements des Barock und Rokoko
Zur Zeit des Hochbarocks ließ die Kurfürstin Henriette Adelaide, seit 1650 Gemahlin Kurfürst Ferdinand Marias (reg. 1651–1679), zwischen 1666 und etwa 1669 das kleinere Appartement ihrer Schwiegermutter zwischen Residenzgasse und Grottenhof zu einer überaus prächtigen Raumfolge erweitern. Es bestand nun aus dem Saal der Garde (Hartschiersaal), zwei Vorzimmern, dem Audienzgemach (Goldener Saal), einem großen Kabinett (Grottenzimmer), dem Schlafzimmer mit Bettalkoven, einer kleinen Kapelle und einem Kabinett (Herzkabinett). Ergänzt wurde diese Raumsequenz durch eine Galerie zwischen Residenzgasse und südlichem Garten und einer gangartigen Bibliothek. Henriette Adelaide orientierte sich bei ihrem Bauprojekt sowohl an Vorbildern ihrer Turiner Heimat als auch an den neusten Pariser Moden. Das Appartement besaß zahlreiche, in Friese und Decken eingelassene Gemälde, die den Räumen jeweils eigene Themen vorgaben. Architekt war Agostino Barelli, während die Raumentwürfe von Antonio Pistorini stammten. 1674 zerstörte ein Brand die ersten drei Räume, während die Kurfürstin ihre Kinder vor dem Feuer rettete und schwer angeschlagen zwei Jahre später starb. Seit dem Papstbesuch Pius VI. 1782 wurde der Rest des Appartements Päpstliche Zimmer genannt. 1944 wurden fast alle diese Räume zerstört; heute gibt nur noch das Herzkabinett einen gewissen Eindruck von dem sozialen Anspruch und künstlerischen Rang dieses Appartementes einer bayerischen Kurfürstin.
Die Erweiterungen von Maximilian II. Emanuel (reg. 1679–1726) (Alexander- und Sommerzimmer als repräsentative Wohnräume) wurden bereits zu seinem Lebensende umgebaut. Die Reste gingen, bis auf einen heute unzugänglichen Raum, im Residenzbrand von 1729 unter.[18] Die Kaiserliche Administration in Bayern ab 1705, als der Kurfürst für zehn Jahre außer Landes und der Hofstaat entlassen war, hatte die Residenz dagegen weitgehend schadlos überstanden, ebenso wie spätere fremde Besatzungen. Während des Exils der kurfürstlichen Familie war zuletzt nur noch Prinzessin Maria Anna in der Residenz verblieben und hielt Kontakt zur in Frankreich, Italien und Österreich verstreuten Familie.
Max Emanuels Nachfolger, der Kurfürst und spätere Kaiser Karl Albrecht (reg. 1726–1745) ließ an der Stelle der Räume seines Vaters die Reichen Zimmer mit der Grünen Galerie, dem Spiegelkabinett und dem Paradeschlafzimmer errichten. Ihr aufwendiges Dekor dominieren das Goldornament auf weißen Wänden und der purpurfarbene, ziselierte Genueser Samt. Nur bei der Grünen Galerie wurde, wie der Name bereits andeutet, ein grüner Seidendamast verwendet. Die Reihenfolge der Räume und ihre verwinkelte Lage gehen dabei auf eine Spiegelung der Räume der Päpstlichen Zimmer zurück. Das Paradeschlafzimmer diente der Zeremonie des morgendlichen Lever. Im Erdgeschoss entstand zwischen 1726 und 1730 die Ahnengalerie mit ihren herrlichen, von Johann Baptist Zimmermann ausgeführten Stuckarbeiten. Die Ahnengalerie enthält heute über hundert Porträts von Mitgliedern des Hauses Wittelsbach bis hin zum letzten König von Bayern, Ludwig III. Dieser Raum sollte außerdem Karl Albrechts Anspruch auf die Kaiserkrone untermauern, indem er diesen von Karl dem Großen, Kaiser Ludwig dem Bayern und dem legendären Agilolfinger Theodo herleitete, deren Porträts er zentral in die Mitte des Raumes stellte. Des Weiteren ließ Karl Albrecht neben der Ahnengalerie ein weiteres prächtiges Kabinett zur Aufbewahrung des Hausschatzes errichten, für den bisher kein spezieller Raum zur Verfügung stand. Seit dem Bau der Alten Schatzkammer unter Prinzregent Luitpold 1897 beherbergt dieser Raum bis heute das Porzellankabinett. Somit dienen alle durch die Hofarchitekten Joseph Effner und François de Cuvilliés errichteten Bauten einzig der Verherrlichung seines Hauses und der Erlangung der Kaiserkrone, was Karl Albrecht 1742 schließlich auch gelang. Als Künstler beteiligt waren neben dem bereits erwähnten Johann Baptist Zimmermann auch Joachim Dietrich und Wenzeslaus Miroffsky. Die zweigeschossige Außenfassade der Grünen Galerie mit sieben Rundbogenfenstern im Königsbauhof ist ein Meisterwerk von Cuvilliés von 1730.[19] Im Januar 1745 starb Karl Albrecht als Kaiser Karl VII. in der Residenz, die somit für kurze Zeit auch Kaiserschloss war.[20]
Karl Albrechts Sohn Kurfürst Maximilian III. Joseph (reg. 1745–1777) hatte jeglichen Ansprüchen auf die Kaiserkrone entsagt, was sich in den von François de Cuvilliés und Johann Baptist Gunetzrhainer eingerichteten Kurfürstenzimmern widerspiegelt. Diese Wohnräume wurden über dem Antiquarium wo sich bis dato die Hofbibliothek befunden hatte, im Stil des Spätrokoko gestaltet.
Klassizistische Erweiterungen
Mit der Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 und den zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorgenommenen großen städtebaulichen Veränderungen Münchens wurden die bis dato wenig repräsentativen, nicht sichtbaren Teile der Residenz freigelegt. Dieser zum Teil einer Residenz unwürdige Zustand hatte bereits Hofarchitekten wie François de Cuvilliés noch zu Zeiten Maximilian III. Josephs zu großzügigen Ausbauplänen veranlasst, die jedoch wegen der leeren Staatskassen nicht verwirklicht wurden. Geplant war nach einem Entwurf von 1764/1765 unter anderem ein großer neuer Flügel an der Ostseite der Residenz. Auch unter dem Nachfolger Karl Theodor (reg. 1777–1799) entstand lediglich an der Nordseite des Hofgartens die 1780/1781 erbaute Churfürstliche Galerie durch den Münchener Oberhofbaumeister Karl Albert von Lespilliez.
König Max I. Joseph (reg. 1799–1825) begnügte sich zunächst wiederum mit der Neueinrichtung von Gemächern anstelle des Kaisersaals und einer Modernisierung des Herkulessaals (des heutigen Max-Joseph-Saals), außerdem ließ er die Staatsratszimmer zwischen Hartschiersaal und den Steinzimmern einrichten.[21] Dabei entstand an der Nordwestseite beim Hofgartentor durch Charles Pierre Puille und Andreas Gärtner eine neue Fassade mit konsolgetragenen Fensterbänken und Architraven auf glattem Mauerwerk im in Frankreich damals üblichen Stil italienischer Renaissance, welche später dem Festsaalbau weichen musste. Im Vergleich zu ihrem Mann hatte Königin Karoline, die hier die Beletage bewohnte, ein größeres Repräsentationsbedürfnis, das sich auch im Umbau der Münchener Residenz zeigte. Max Joseph dagegen, der einen eher bürgerlichen Lebensstil bevorzugte, wohnte im Mezzanin, nahe seiner Kinder. Die Charlottenzimmer wurden dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Stil des Empire für eine Tochter Max Josephs dekoriert. Des Weiteren ließ der König dann zwischen 1811 und 1818 südlich des Residenztheaters anstelle des 1802 abgebrochenen Franziskanerklosters das Königliche Hof- und Nationaltheater vor dem späteren Max-Joseph-Platz nach Plänen von Karl von Fischer errichten.[22] Nach der Neugestaltung dieses Platzes an der Südseite begann 1816 mit den Planungen für den Odeonsplatz auch der nordwestliche Zugang zur Residenz zunehmend repräsentativer zu werden. Hier entstand das Hofgartentor, Leo von Klenzes erstes Werk in München (1816/1817), es bildet den Einlass in den Hofgarten auf der Achse der Brienner Straße. Erst ab 1817 wurden dann, zunächst für die Marstallgebäude, die Bauarbeiten aufgenommen, die bald aus der Residenz einen der größten Stadtpaläste machen sollten. Bereits ab 1801 war allerdings an der Ostseite des Hofgartens die gewaltige Hofgartenkaserne entstanden, die gut hundert Jahre später dem Armeemuseum (heutige Staatskanzlei) weichen musste.
Den heutigen Umfang erreichte die Anlage zwischen 1825 und 1842 unter König Ludwig I. (reg. 1825–1848) mit den von Leo von Klenze im Stil des Klassizismus errichteten Flügeln des Königsbaus und des Festsaalbaus sowie der Allerheiligen-Hofkirche.[23] Mit den Erweiterungsbauten entstanden zahlreiche weitere Raumfluchten.

Die kreisfreie Stadt Münster (münsterländisch Mönster, niederländisch: Munster, friesisch: Múnster, altsächsisch Mimigernaford, lateinisch Monasterium) in Westfalen ist Sitz des gleichnamigen Regierungsbezirks im Land Nordrhein-Westfalen. Von 1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen. Die Stadt an der Münsterschen Aa liegt zwischen dem Ruhrgebiet und Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes und ist als zwanzigstgrößte Stadt Deutschlands eines der Oberzentren des Landes Nordrhein-Westfalen.
Münster ist seit 1915 eine Großstadt, im Jahr 2014 überstieg ihre Einwohnerzahl erstmals die Marke von 300.000 Personen. Mit 65.000 Studenten (2018)[2] gehört Münster zu den zehn größten Universitätsstädten Deutschlands.[3] Außerdem ist Münster durch sein fahrradfreundliches Stadtbild als Fahrradstadt bekannt.[4]
Die Stadt ist ein wichtiger Dienstleistungs- und Verwaltungsstandort und Sitz mehrerer Hochschulen. Wichtige Gerichte und Verwaltungseinrichtungen für das Land Nordrhein-Westfalen sind in Münster ansässig, darunter der Verfassungsgerichtshof und das Oberverwaltungsgericht. Die ehemalige westfälische Provinzialhauptstadt ist heute Sitz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Münster ist Sitz eines katholischen Bischofs. Im Jahre 799 gründete Papst Leo III. bei seinem Treffen mit Karl dem Großen das Bistum Münster sowie die Diözesen Osnabrück, Minden und Paderborn. 805 wurde der heilige Ludgerus im Kölner Dom zum ersten Bischof von Münster geweiht. Seit 2009 ist Felix Genn der Bischof.
Bekannt ist Münster für seine nach dem Zweiten Weltkrieg zu Teilen rekonstruierte historische Altstadt.
Jährlich kommen rund 19,5 Millionen Tagesgäste nach Münster.[204] Ungefähr 637.000 Gäste, davon etwa 66.000 aus dem Ausland, bleiben über Nacht und buchen im Durchschnitt zwei Übernachtungen. Für sie stehen in den 80 Beherbergungsbetrieben innerhalb der Stadtgrenzen ungefähr 8200 Betten zur Verfügung.[205]
Besonders für Eintagesgäste ist Münster als Einkaufsstadt beliebt. Die regionalen Feste wie das Eurocityfest, der Weihnachtsmarkt und der Jahrmarkt Send sowie die Ende August stattfindende Montgolfiade mit Ballonglühen am Aaseeufer[206] ziehen viele auswärtige Gäste an. Zur besseren Verständigung mit niederländischen Gästen werden bei großen Veranstaltungen auch niederländische Polizisten in Münster eingesetzt. Eine Unternehmensberatung ermittelte 2006, dass der Tourismus jährlich rund 850 Millionen Euro nach Münster brachte.[207]
Die Stadt Münster bietet über den Verein StadtLupe Münster e. V. Rundgänge an, zum Beispiel eine Altstadt-Tour und eine „ArchitekTour“.[208] Der gemeinnützige Verein StattReisen Münster bietet Rundgänge an;[209] es gibt auch Stadtrundgänge zur Frauengeschichte in Münster.[210]
Seit dem Gewinn des LivCom-Awards wirbt Münster mit dem Titel lebenswerteste Stadt der Welt. Unter anderem wurden Plakate mit dem Satz „Münster ist die lebenswerteste Stadt der Welt“ und Szenen aus dem Stadtleben verteilt. Jeder münstersche Haushalt bekam außerdem zwei Postkarten mit Werbung für die Stadt. 2005 startete die Stadt die Image-Kampagne geheimtipp-muenster. 2009 wurde der Aasee-Park als „Schönster Park Europas“ ausgezeichnet,[211] nachdem er bereits 2008 zu „Deutschlands schönstem Park“ gewählt worden war.[212]

Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist ein deutscher Nationalpark. Er erstreckt sich auf einer Fläche von 93,5 km² über die rechtselbischen Kerngebiete des Elbsandsteingebirges im Freistaat Sachsen. Gegründet wurde der Nationalpark am 1. Oktober 1990 im Rahmen des Nationalparkprogramms der DDR.
Zusammen mit dem umliegenden, 1956 gegründeten Landschaftsschutzgebiet bildet der Nationalpark die Nationalparkregion Sächsische Schweiz. Im benachbarten Tschechien setzt sich das Schutzgebiet im Nationalpark Böhmische Schweiz fort.
Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist eine der wichtigsten Attraktionen im Elbsandsteingebirge: Mit jährlich 1,7 Millionen Besuchern erwirtschaftet der Tourismus in der Nationalparkregion so viel, dass damit rechnerisch der Lebensunterhalt von 1.878 Personen gesichert ist.[1]
Der Nationalpark Sächsische Schweiz liegt – in zwei räumlich getrennten Bereichen – im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
Westlicher Bereich
Dieser Bereich umfasst das Basteigebiet, den Lilienstein und das Polenztal. Im Westen begrenzen die Gemeinden Stadt Wehlen und Lohmen, im Norden die Gemeinden Lohmen und Hohnstein, im Osten Hohnstein und Goßdorf und im Süden die Gemeinden Bad Schandau, Rathen und Stadt Wehlen diesen Bereich. Die Gemeinde Waitzdorf liegt vollständig in diesem Gebiet. Bedeutende Berge sind der Lilienstein (415 m ü. NHN), die Bastei (305 m ü. NHN), der Hockstein (291 m ü. NHN) und der Brand (317 m ü. NHN). Der durch den Amselgrund zur Elbe fließende Grünbach mit dem Amselsee und die Polenz sind die einzigen nennenswerten Gewässer.
Östlicher Bereich
Der östliche Teil umfasst das Gebiet der Schrammsteine, des Großen Winterberges, des Großen Zschandes und der Hinteren Sächsischen Schweiz. Im Westen begrenzen die Gemeinde Bad Schandau und der Ortsteil Altendorf und im Norden die Sebnitzer Ortsteile Altendorf, Ottendorf und Hinterhermsdorf dieses Gebiet. Im Osten und im Süden grenzt dieser Bereich an den Nationalpark Böhmische Schweiz. Von Schmilka bis Bad Schandau ist die Elbe die südliche Grenze dieses Bereiches. Bedeutende Berge sind der Große Winterberg (556 m ü. NHN), der Neue Wildenstein mit Felsentor Kuhstall (337 m ü. NHN) und der Raumberg (459 m ü. NHN). Die Kirnitzsch ist das einzige nennenswerte Gewässer.[2][3]
UNESCO-Weltnaturerbe
Am 10. Mai 2004 beschloss der Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz die Nominierung von Teilen der Sächsischen Schweiz als Weltnaturerbe der UNESCO. Die betroffenen Städte und Gemeinden beschlossen nachfolgend die Nominierung zu unterstützen. Da das Elbsandsteingebirge grenzüberschreitend ist, wurden auch auf tschechischer Seite Beschlüsse zur Nominierung der Böhmischen Schweiz als Weltnaturerbe getroffen. Am 30. Juni 2005 wurde durch den Bürgermeister der Stadt Děčín, dem Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz und dem Tourismusverband Sächsische Schweiz eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.
Im Auftrag des Landkreises erstellte die Freiberger Firma GEOmontan eine Potenzialanalyse,[28] die die Sächsisch-Böhmische Schweiz als einmaliges Beispiel für erdzeitliche Veränderungen charakterisiert. Die Studie wurde am 22. Februar 2006 geladenen Gästen vorgestellt.

Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK; internationale Bezeichnung Kiel Canal, in Deutschland bis 1948 Kaiser-Wilhelm-Kanal) verbindet die Nordsee (Elbmündung) mit der Ostsee (Kieler Förde). 1887 erfolgte die Grundsteinlegung und bereits 1895 die Eröffnung der kleinen Doppelschleuse Brunsbüttel und Holtenau. 1914 wurden die großen Doppelschleusen in Brunsbüttel und Holtenau eröffnet. Diese Bundeswasserstraße[3] gehört weltweit zu den meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen für Seeschiffe.
Im Jahr 2019 passierten ihn 28.797 Schiffe, im Jahr 2018 waren es 30.009 Schiffe.[4]
Der Kanal durchquert auf seiner Länge von knapp 100 Kilometern das Land Schleswig-Holstein zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau. Damit erspart er die Fahrt um die Kimbrische Halbinsel (Jütland) durch Nordsee, Skagerrak und Kattegat. Mit dem Kanal ist die Wegstrecke je nach Abfahrts- und Zielhafen im Schnitt 250 Seemeilen (rund 460 km) kürzer.
Die erste Verbindung zwischen Nord- und Ostsee für seegängige Schiffe war der 1784 in Betrieb genommene und 1853 in Eiderkanal umbenannte Schleswig-Holsteinische Canal.
Der Kanal hat auf seiner kompletten Länge denselben Wasserstand und gehört damit zu den spiegelgleichen Seekanälen. Er wird an beiden Enden durch Schleusen gegen die wechselnden Wasserstände, verursacht durch den Gezeitengang der Nordsee bzw. einen Windstau im Bereich der Ostsee, abgeschlossen. Die Endpunkte befinden sich in Brunsbüttel an der Unterelbe (Km 0,38)[1] und in Kiel-Holtenau an der Kieler Förde (Km 98,64).[1] Sie liegen 98,26 km auseinander (Luftlinie 85½ km). Die Gewässerkennzahl 5978 ordnet den Kanal offiziell dem Flusssystem der Elbe zu.
Der Kanal passiert verschiedene Landschaftszonen Schleswig-Holsteins.[5] Zunächst durchquert er die Marsch und durchschneidet dann einen Geestrücken. Auf dieser Strecke orientiert sich der Verlauf des Kanals zwischen Burg (Dithmarschen) und Schafstedt am Verlauf der Holstenau und von Kilometer 41 bis über Rendsburg hinaus dann an der Eiderniederung, in deren Flussbett er nordöstlich von Rendsburg verläuft. Dann erreicht der Kanal das östliche Hügelland. Zwischen Rendsburg, der wichtigsten Hafenstadt im Verlauf des Kanals, und Kiel bildet der Kanal die Grenze zwischen den Landesteilen Schleswig und Holstein.
Bei Kilometer 40,66 zweigt seit 1937 nach Norden der Gieselaukanal als Verbindung zur Untereider ab. Zum Nord-Ostsee-Kanal gehören als Bundeswasserstraßen[3] noch auf seiner Nordwestseite der Borgstedter See mit Enge nordöstlich von Rendsburg sowie auf seiner Südseite der Flemhuder See bei Kilometer 85,32 und der Achterwehrer Schifffahrtskanal bei Kilometer 85,63. Bis 1913 mündete die Obereider durch den Flemhuder See, seitdem fließt das Wasser durch den Achterwehrer Schifffahrtskanal in den Nord-Ostsee-Kanal ein. Etwa 1200 Quadratkilometer des ursprünglichen Einzugsgebiets der Eider entwässern in den Nord-Ostsee-Kanal. Bis 2008 gehörte die seeartig erweiterte Obereider zwischen Nord-Ostsee-Kanal und Rendsburg zum Kanal.[6]
Der Kanal entwässert insgesamt ein Gebiet von 1580 Quadratkilometer, wovon 250 Quadratkilometer durch Schöpfwerke künstlich entwässert werden. Dabei fließen zwischen 4 m³/s und 190 m³/s in den Kanal, im Schnitt sind es 20 m³/s. Das Wasser fließt vor allem bei Brunsbüttel in die Elbe, die hier dem Tideeinfluss der Nordsee unterliegt.
Im Unterschied zu flacheren Binnenkanälen sind im Nord-Ostsee-Kanal nur die Uferbereiche zwischen einem Meter über und bis zu zwei Metern unter dem Wasserspiegel zum Schutz befestigt. Hier liegen 15 bis 50 Kilogramm schwere Steine auf einer 30 bis 50 Zentimeter dicken Kiesschicht. Bei weichen Untergründen wie Torf oder Klei liegen diese auf einer Buschmatte, um das Gewicht optimal zu verteilen. Um den Kanal schiffbar zu halten, werden jährlich 6½ Millionen m³ Nassschlick in Brunsbüttel ausgebaggert, im restlichen Kanal noch einmal 100.000 m³ Erosionsmaterial. Der Einsatz der Baggerschiffe birgt dabei zum einen ein Kollisionsrisiko für den Schiffsverkehr, zum anderen scheint insbesondere der Einsatz von Saugbaggern die Ökologie des Kanals zu stören.
Acht Straßen und vier Eisenbahnstrecken überqueren den Nord-Ostsee-Kanal auf insgesamt zehn Brücken, dreizehn Fahrzeug- und eine Personenfähre ermöglichen den Transport auf die andere Seite, und bei Rendsburg existieren seit 1961 ein Straßen- und ein Fußgängertunnel. Bekannt ist die in Rendsburg befindliche Eisenbahnhochbrücke mit der darunter hängenden Schwebefähre. Alle Brücken haben die gleiche Durchfahrtshöhe von 42 Metern für die Schifffahrt, weil der Kanal beim Bau für die Linienschiffe der Deutschlandklasse der kaiserlichen Marine ausgelegt wurde.
 Saxony
Saxony
 Important port
Important port
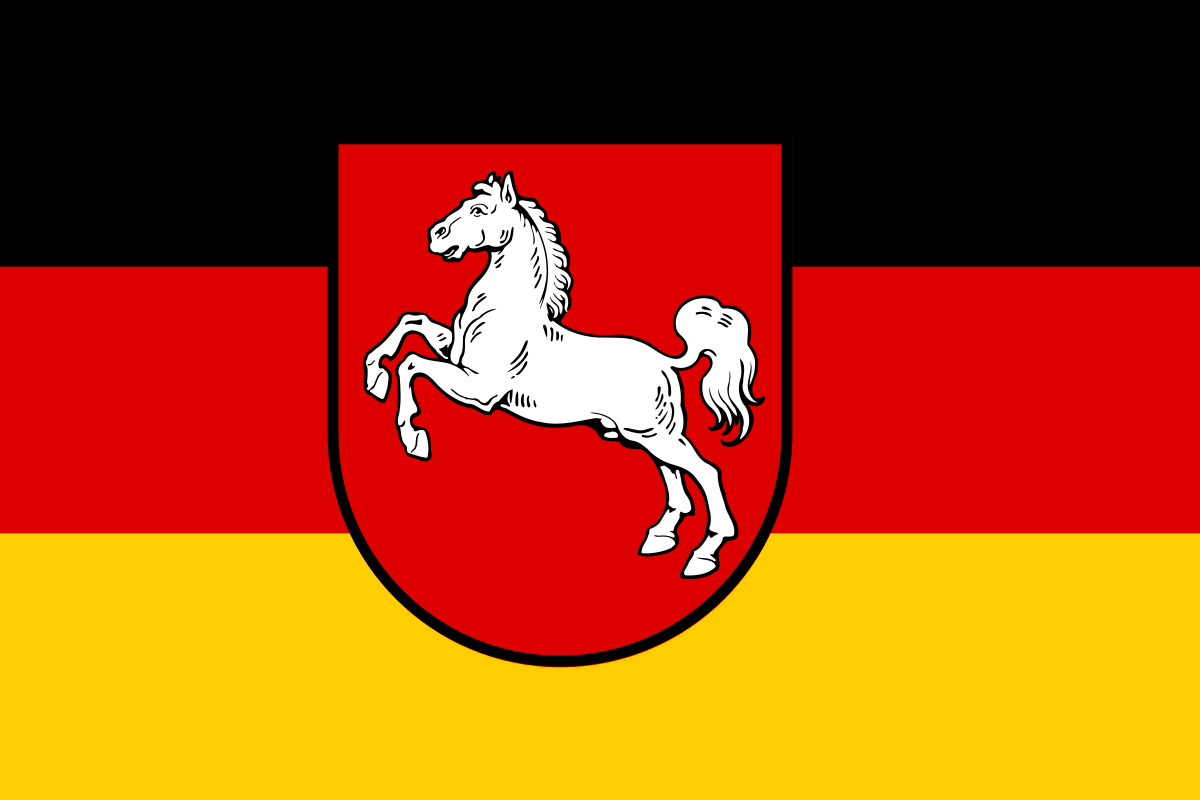 Lower Saxony
Lower Saxony
 Saxony-Anhalt
Saxony-Anhalt
 Baden-Wuerttemberg
Baden-Wuerttemberg
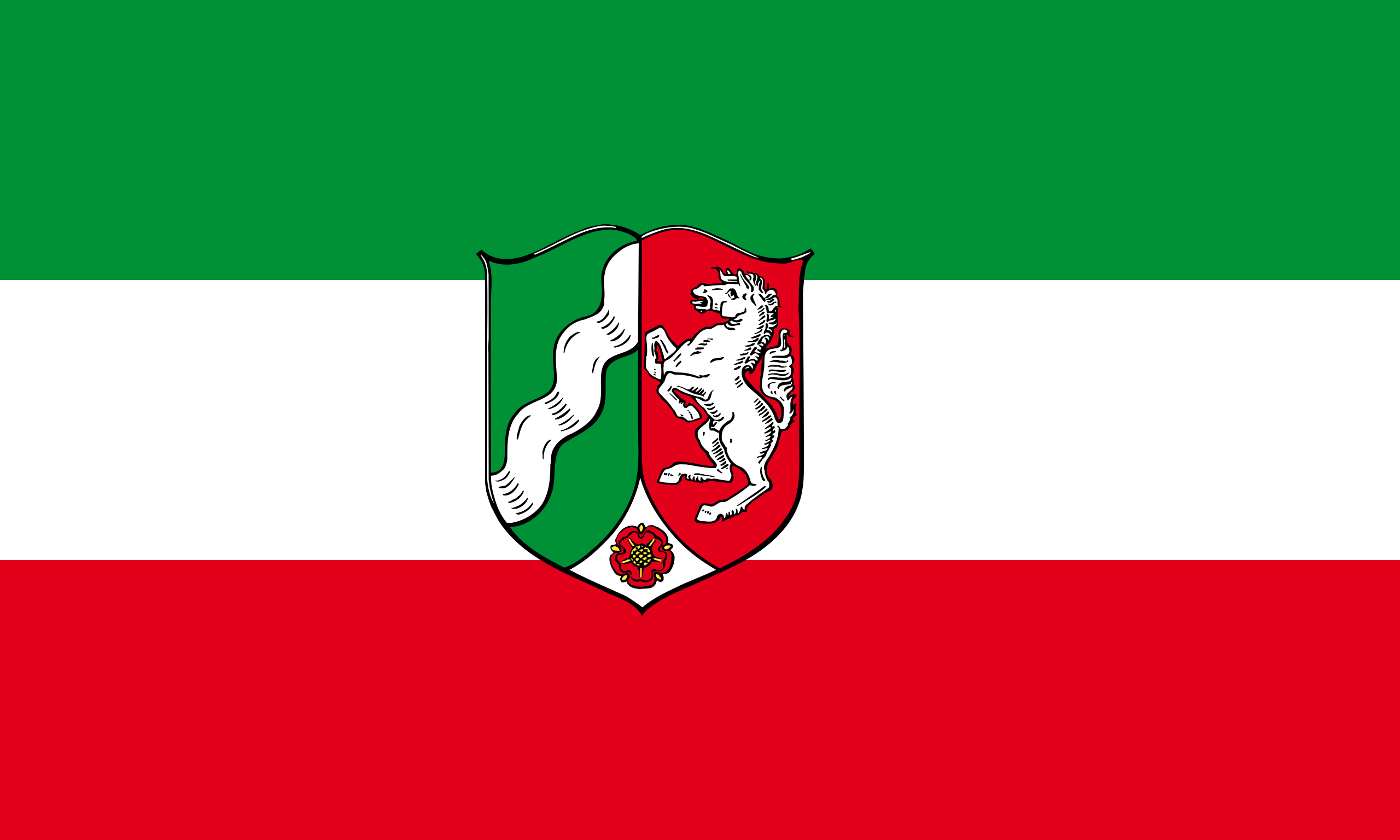 North Rhine-Westphalia
North Rhine-Westphalia
 Animal world
Animal world
 Geography
Geography