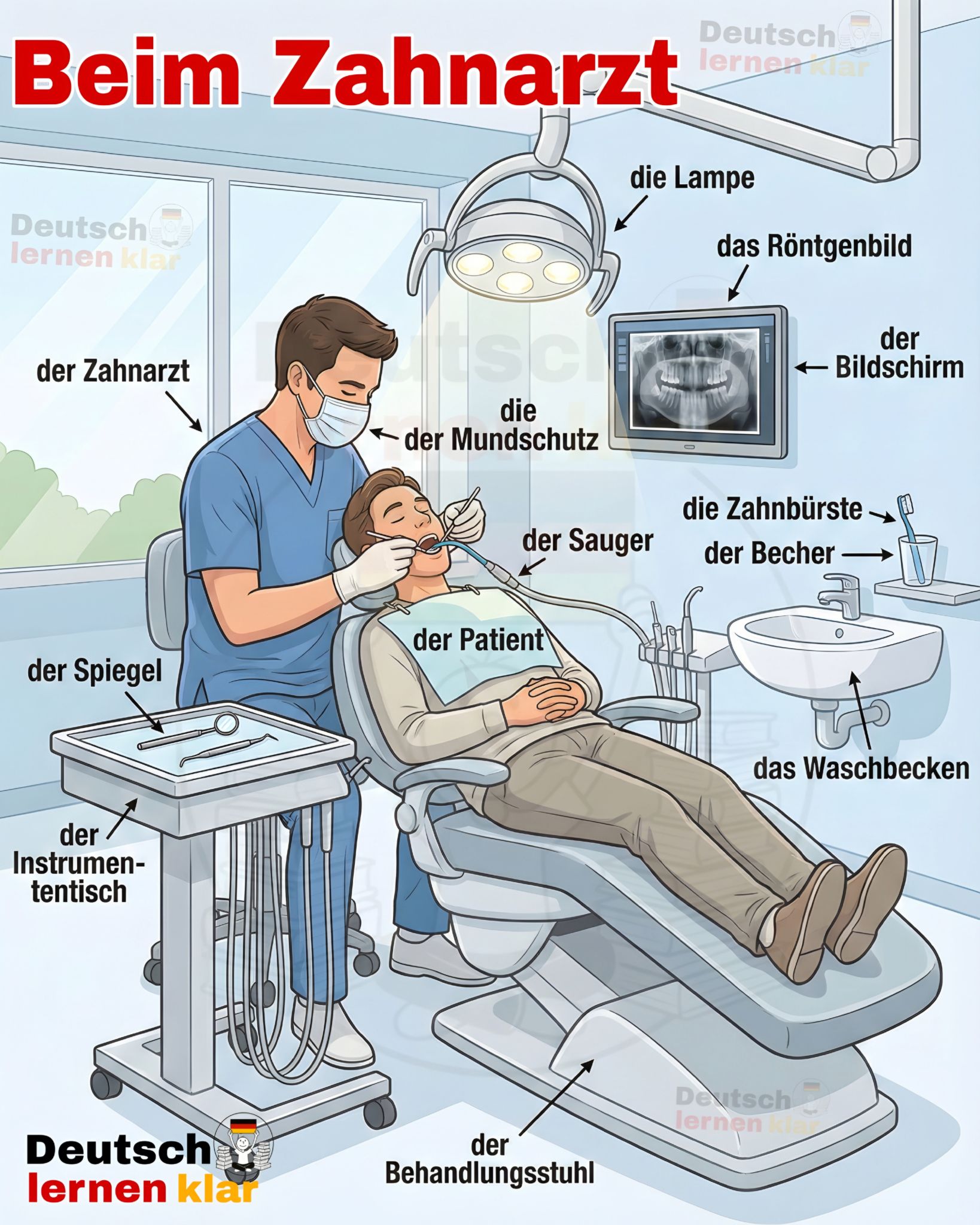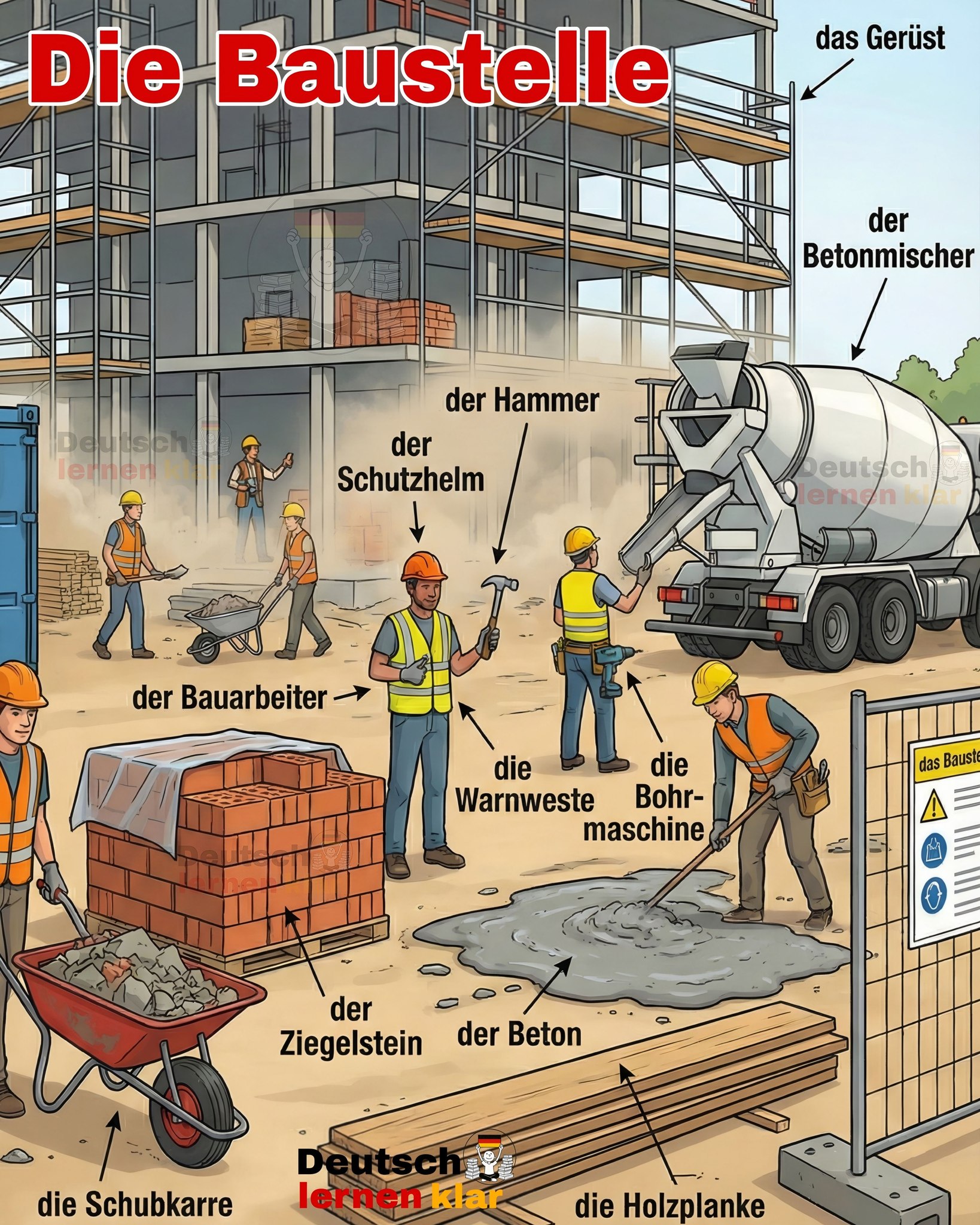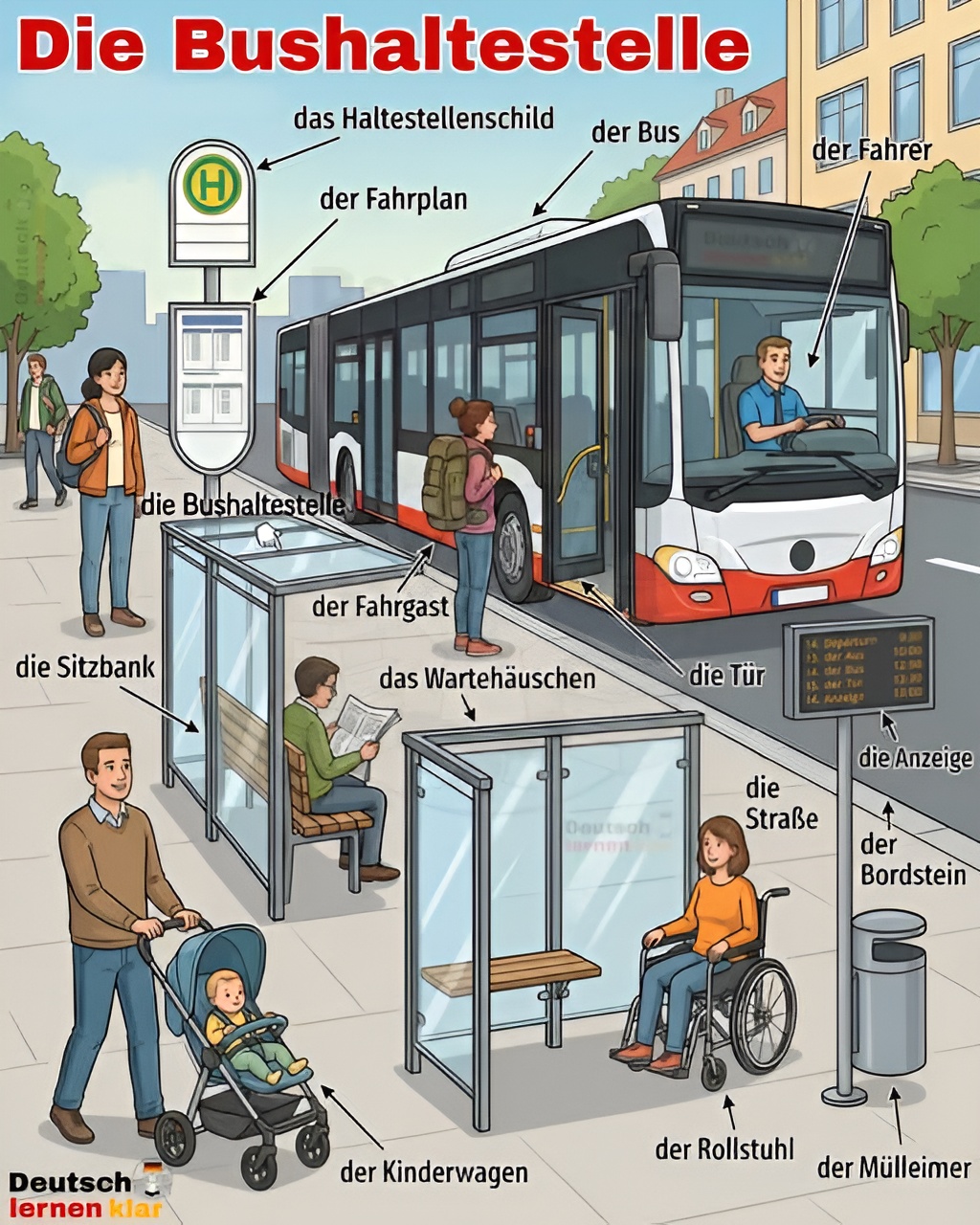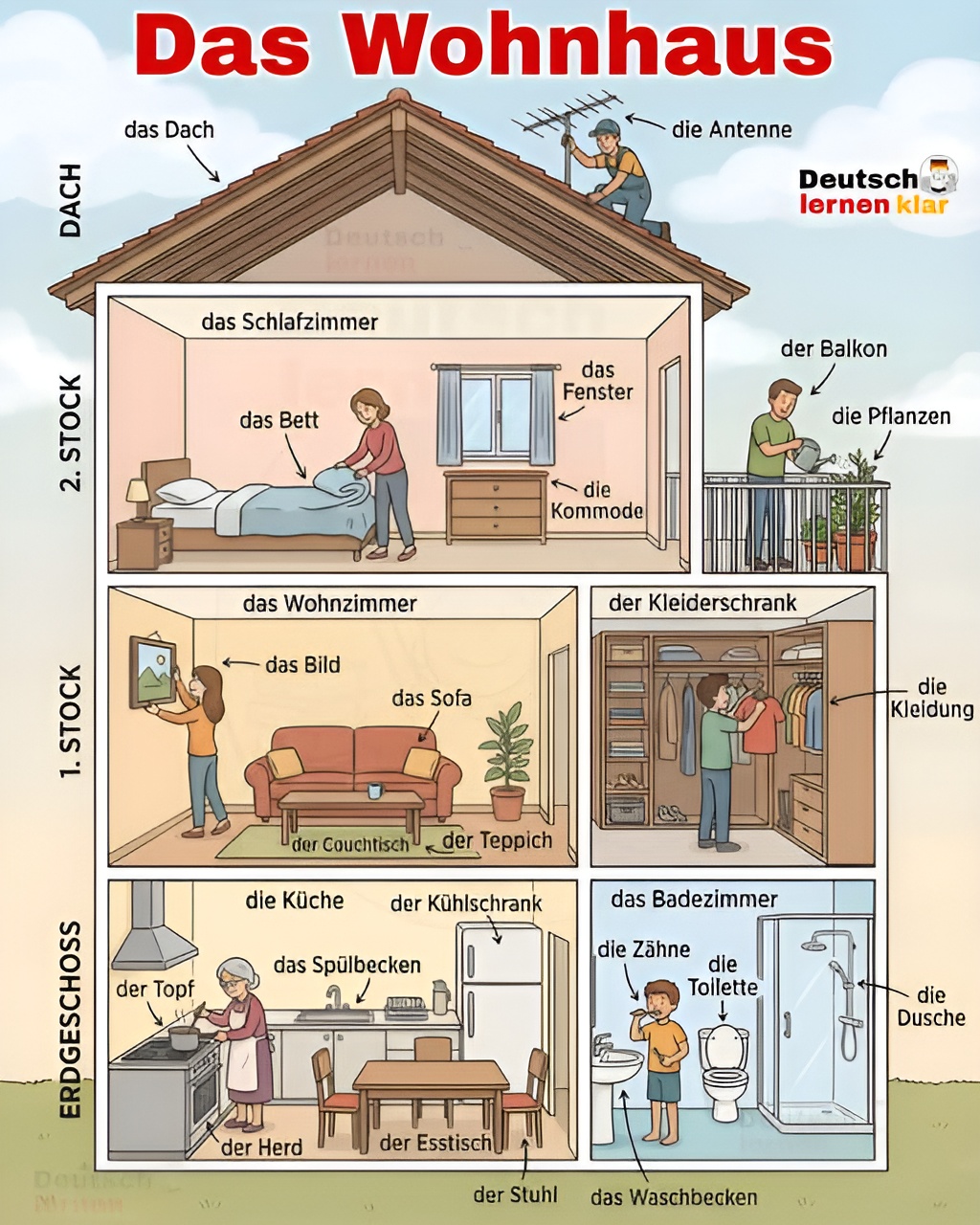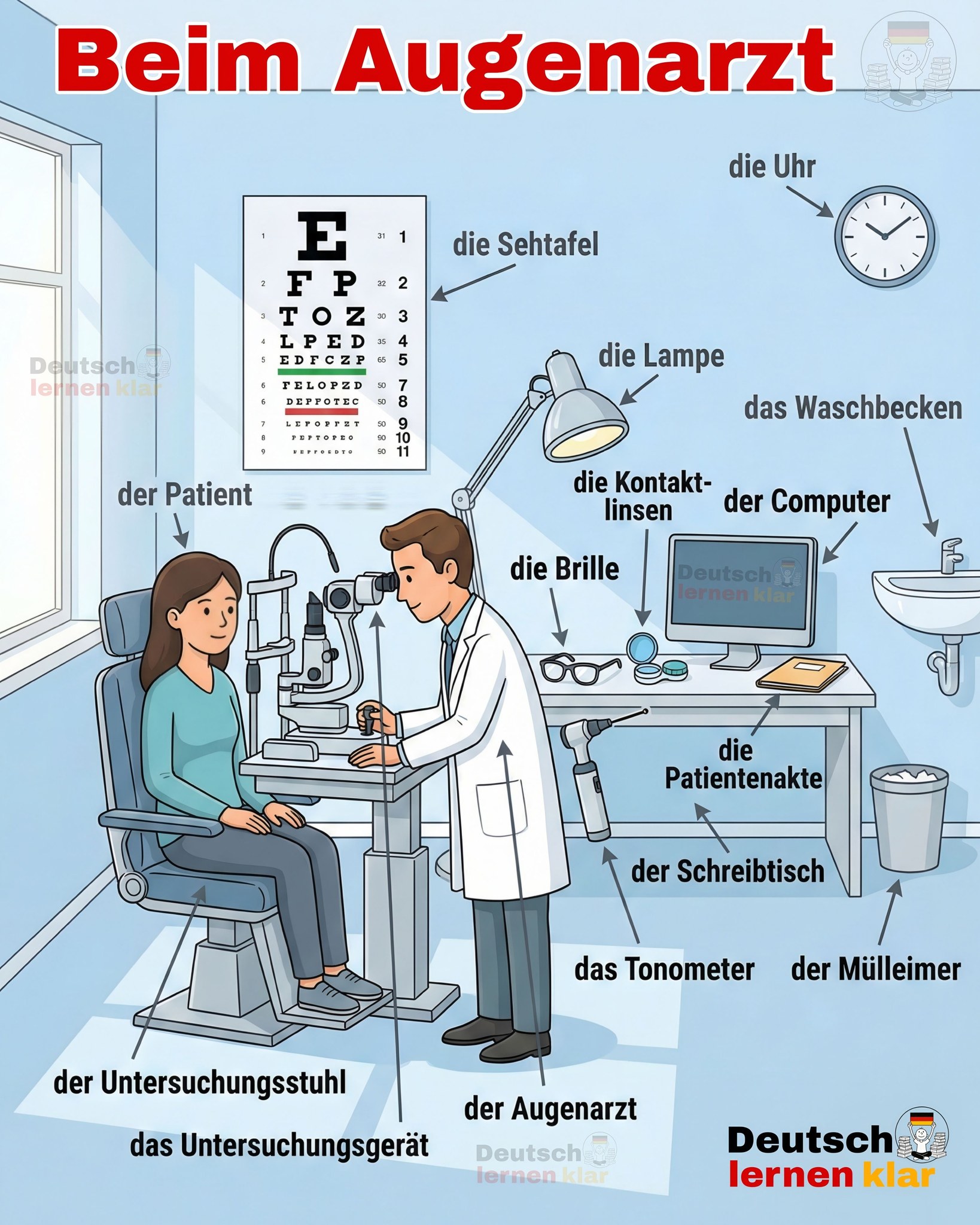Deutsche Grammatik: Verben
Deutsche Grammatik: Verben  Deutsche Grammatik: Substantive
Deutsche Grammatik: Substantive  Deutsche Grammatik: Artikel
Deutsche Grammatik: Artikel
 Deutsche Grammatik: Adjektive
Deutsche Grammatik: Adjektive  Deutsche Grammatik: Adverbien
Deutsche Grammatik: Adverbien  Deutsche Grammatik: Präpositionen
Deutsche Grammatik: Präpositionen
 Deutsche Grammatik: Pronomen
Deutsche Grammatik: Pronomen  Deutsche Grammatik: Satzbau
Deutsche Grammatik: Satzbau  Deutsche Grammatik: Konnektoren
Deutsche Grammatik: Konnektoren
Grammatik ist die Theorie der Sprache. Sie ist wie ein Baukasten, dessen einzelne Elemente klassifiziert werden.
Das Wort Grammatik kommt ursprünglich aus dem Griechischen. Gramma (γράμμα) heißt ‚das Geschriebene oder der Buchstabe‘. Unter Grammatik verstehen wir heute die Sammlung von Regeln der Struktur einer Sprache. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du einen Fehler gemacht hast, kannst Du Deinen Deutschlehrer oder Deine Freunde fragen: „Ist das grammatikalisch richtig?“
Die deutsche Sprache gehört zur Familie der germanischen Sprachen. Andere große germanische Sprachen sind Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Isländisch und Niederländisch. Die deutsche Sprache hat ziemlich schwierige Regeln bei der Satzstellung, beispielsweise ändert sich die Position des Verbs abhängig davon, ob es sich um einen Nebensatz oder Hauptsatz handelt. Im Niederländischen ist das beispielsweise genauso. In der deutschen Sprache gibt es auch eine vergleichsweise große Zahl an Wortformen. Jeder, der schon länger Deutsch lernt, weiß, wovon ich spreche. Es ist ein bisschen wie Mathematik – die Endungen von Adjektiven oder Substantiven können von verschiedenen Faktoren abhängig sein: Genus + Kasus + Numerus = Endung des Substantivs + richtiger Artikel. ?
Du musst Dir keine Sorgen machen. Deutsch lernen ist gar nicht so schwierig, wie es am Anfang aussieht. Wenn man das richtige Lernsystem hat, macht das Lernen der deutschen Sprache sogar Spaß!

Er war 37 Jahre alt, ein berühmter Autor und gut bezahlter Minister. Trotzdem reiste er bei Nacht und Nebel nach Italien. In zehn Jahren am herzoglichen Hof von Weimar hatte Johann Wolfgang von Goethe schnell Karriere gemacht. Doch er konnte kaum etwas verändern, und die Amtsgeschäfte ließen ihm immer weniger Zeit zum Schreiben. Auch die Beziehung zur verheirateten Charlotte von Stein wurde immer quälender.
Seine Krise glaubte er nur durch eine radikale Veränderung der Lebensumstände bewältigen zu können. Also machte er sich im Herbst 1786 auf den beschwerlichen, rund 1.500 Kilometer langen Weg nach Rom und gab sich, um inkognito bleiben zu können, im Personenstandsregister der nahen Pfarrei als »Filippo Miller, Deutscher, 32 Jahre alt« aus. Die ersten beiden Nächte verbrachte Goethe in einem bescheidenen Gasthaus. Dann ließ er den deutschen Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, der ihm noch einen Gefallen schuldete, zu sich rufen und zog noch in derselben Stunde in dessen Künstler-Wohngemeinschaft in der Via del Corso.
Wie sehr der Dichter in insgesamt 15 Monaten das lockere, ungezwungene Alltagsleben dort genoss, lässt ein Besuch in seinem ehemaligen Zuhause erahnen. Dort muss der Besucher an einem normalen Wohnhaus klingeln und in den ersten Stock zur »Casa di Goethe« gehen. Mobiliar aus dem 18. Jahrhundert gibt es nicht mehr. Doch eine Dauerausstellung mit vielen Originalzeichnungen und Beschreibungen vermittelt ein eindrucksvolles und authentisches Bild seines Aufenthaltes, dem Leben mit den Künstlerfreunden, dem gemeinsamen Zeichnen, Diskutieren und Feiern. Die Zeichnung »Das verfluchte zweite Kissen« verrät, dass der Dichterfürst offenbar auch regelmäßigen Damenbesuch hatte. Vom Tischbein-Atelier aus (mit einer Kopie des berühmten Gemäldes »Goethe in der Campagna «, siehe oben) hat man einen tollen Blick auf den zu jeder Tageszeit belebten Corso. (Quelle: https://www.reise-nach-italien.de/casadigoethe.html)

Was ist der Konjunktiv?
Konjunktiv verwenden wir im Deutschen für Situationen, die nicht real, sondern nur möglich sind, z. B. wenn wir uns etwas vorstellen oder wünschen, Konjunktiv finden wir auch im Hauptsatz von irrealen Konditionalsätzen oder wenn wir eine Äußerung in der indirekten Rede wiederholen.
Lerne in unserer Erläuterung den Unterschied zwischen Konjunktiv I und Konjunktiv II in Bildung und Verwendung. In den Übungen kannst du dein Wissen testen.
Konjunktiv I
Konjunktiv I finden wir hauptsächlich in Zeitungstexten und Nachrichten, wenn Aussagen in der indirekten Rede wiedergegeben werden. Aber auch in einigen festen Wendungen kommt Konjunktiv I vor.
Beispiel
Nachrichten
Hoch lebe das Geburtstagskind! Zu seinem 90. Geburtstag sagte der Schauspieler, er habe sich noch nie so jung gefühlt.
Wann verwendet man Konjunktiv I?
Konjunktiv I verwenden wir für:
- einige feste Wendungen
Beispiel:
Hoch lebe das Geburtstagskind!
- indirekte Rede (in der Umgangssprache bevorzugen wir aber oft Indikativ, siehe Indirekte Rede)
Beispiel:
Er sagt, er habe sich noch nie so jung gefühlt.
Wie bildet man Konjunktiv I?
- Nur das Verb sein ist im Konjunktiv I noch in allen Formen üblich:
ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seienBeispiel:
Er sagte, sie seien im Kino.
- Bei allen anderen Verben verwenden wir Konjunktiv I meist nur noch in der 3. Person Singular (er/sie/es/man). Dazu müssen wir nur das n vom Infinitiv entfernen. (Die Modalverben sind noch in der 1. und 3. Person Singular üblich.)
Beispiel:
haben – er habe
schreiben – er schreibe
müssen - ich müsse, er müsse - In der 2. Person (du/ihr) unterscheiden sich Konjunktiv I und Indikativ nur durch das e beim Konjunktiv I. Oft bevorzugen wir deshalb Konjunktiv II – so lässt sich die Form besser vom Indikativ unterscheiden.
Beispiel:
du träumst – du träumest
ihr geht – ihr gehet - Für die 1. Person Singular (ich) und die 1./3. Person Plural (wir, sie) unterscheidet sich Konjunktiv I nicht vom Indikativ. Deshalb müssen wir für diese Personen Konjunktiv II verwenden. (Ausnahme: Modalverben - siehe oben)
Beispiel:
„Sie gehen joggen.“ – Er sagt, sie gingen joggen. (Konj. II)
Beispiel für deutsche Zeiten im Konjunktiv I
Den Konjunktiv I können wir im Präsens, Perfekt und Futur bilden. In der folgenden Übersicht gibt es für jede Zeitform je ein Beispiel für Verben, die das Perfekt mit haben/sein bilden.
| Konjunktiv I | ||
|---|---|---|
| Präsens | er gehe | er sage |
| Perfekt | er sei gegangen | er habe gesagt |
| Futur I | er werde gehen | er werde sagen |
| Futur II | er werde gegangen sein | er werde gesagt haben |
Die Reise Goethes nach Italien (September 1786 - Juni 1788) war eine Art Flucht. Die langjährige Arbeit als Minister in Weimar hatte seine literarische Kreativität blockiert und er fühlte die Notwendigkeit eines radikalen Tapetenwechsels. Italien war schon seit der Kindheit sein Traum gewesen, und er hoffte, dass eine solche stimulierende Umgebung zu seiner künstlerischen Wiedergeburt führen würde.
Was Goethe in Italien suchte, war nicht so sehr das Italien von Michelangelo und Leonardo, der Malerei und der Architektur der Renaissance und des Barock. Goethe suchte das klassische Italien der griechisch-römischen Kultur und als er in Verona zum ersten Mal ein Monument der römischen Antike sah, die Arena, war er glücklich. Und in Rom fühlte er sich sofort wie zu Hause, als ob er nie woanders gelebt hätte.
Als er auf der Hinreise in Malcesine (an der Ostküste des Gardasees), das damals an der Grenze zwischen der Republik Venedig und Österreich lag, übernachtete und am nächsten Morgen die Burgruine der Stadt zeichnete, hielten ihn die Einwohner von Malcesine anfangs für einen österreichischen Spion, der mit seinen Zeichnungen im Auftrag des österreichischen Kaisers Josef II einen eventuellen Angriff vorbereiten sollte und so musste er sich vor der Bevölkerung und vor den örtlichen Autoritäten verteidigen. Zum Glück klärte sich das Missverständnis rasch auf.
Im Folgenden ein Ausschnitt aus dem Reisetagebuch von Goethe, wo er diesen Zwischenfall schildert:
13. September 1786
Heute früh um drei Uhr fuhr ich von Torbole weg mit zwei Ruderern. Anfangs war der Wind günstig, daß sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Dämmerung still. Wir fuhren bei Limone vorbei, dessen Berggärten, terrassenweise angelegt und mit Zitronenbäumen bepflanzt, ein reiches und reinliches Ansehn geben. Der ganze Garten besteht aus Reihen von weißen viereckigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung voneinander stehen und stufenweis den Berg hinaufrücken. Über diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Bäume zu decken. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegenstände ward durch eine langsame Fahrt begünstigt, und so waren wir schon an Malcesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt, und so mußten wir im Hafen von Malcesine landen. Es ist der erste venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu tun hat, kann man nicht sagen, ich werde heute da oder dort sein. Diesen Aufenthalt will ich so gut als möglich nutzen, besonders das Schloß zu zeichnen, das am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ist. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Skizze davon.
14. September 1786
Der Gegenwind, der mich gestern in den Hafen von Malcesine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung lustig finde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich morgens beizeiten in das alte Schloß, welches ohne Tor, ohne Verwahrung und Bewachung jedermann zugänglich ist. Im Schloßhofe setzte ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Turm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden; neben einer drei, vier Stufen erhöhten verschlossenen Tür, im Türgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antreffen.
Ich saß nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Hof herein, betrachteten mich und gingen hin und wider. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so daß sie mich zuletzt umgab. Ich bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Aufsehen erregt hatte, ich ließ mich aber nicht stören und fuhr ganz gelassen fort. Endlich drängte sich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Ansehen, und fragte, was ich da mache. Ich erwiderte ihm, daß ich den alten Turm abzeichne, um mir ein Andenken von Malcesine zu erhalten. Er sagte darauf, es sei dies nicht erlaubt, und ich sollte es unterlassen. Da er dieses in gemeiner venezianischer Sprache sagte, so daß ich ihn wirklich kaum verstand, so erwiderte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. Er ergriff darauf mit wahrer italienischer Gelassenheit mein Blatt, zerriß es, ließ es aber auf der Pappe liegen. Hierauf konnt' ich einen Ton der Unzufriedenheit unter den Umstehenden bemerken, besonders sagte eine ältliche Frau, es sei nicht recht, man solle den Podestà rufen, welcher dergleichen Dinge zu beurteilen wisse. Ich stand auf meinen Stufen, den Rücken gegen die Türe gelehnt, und überschaute das immer sich vermehrende Publikum. Die neugierigen starren Blicke, der gutmütige Ausdruck in den meisten Gesichtern und was sonst noch alles eine fremde Volksmasse charakterisieren mag, gab mir den lustigsten Eindruck. Ich glaubte, das Chor der Vögel vor mir zu sehen, das ich als Treufreund auf dem Ettersburger Theater oft zum besten gehabt. Dies versetzte mich in die heiterste Stimmung, so daß, als der Podestà mit seinem Aktuarius herankam, ich ihn freimütig begrüßte und auf seine Frage, warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erwiderte, daß ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anerkenne. Ich machte ihn und das Volk aufmerksam auf den Verfall dieser Türme und dieser Mauern, auf den Mangel von Toren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Zustandes und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.
Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine sei, was denn dran wohl besonders scheinen könne? Ich erwiderte darauf, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr umständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe, welche hundert- und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Altertum so erhalten sei, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.
Der Podestà, welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann von etwa dreißig Jahren. Die stumpfen Züge seines geistlosen Gesichts stimmten ganz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Aktuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltnen Fall auch nicht gleich finden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen; man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich, Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.
Als ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähnte, das man im Lande unter dem Namen Arena kennt, sagte der Aktuarius, der sich unterdessen besonnen hatte, das möge wohl gelten, denn jenes sei ein weltberühmtes römisches Gebäude, an diesen Türmen aber sei nichts Merkwürdiges, als daß es die Grenze zwischen dem Gebiete Venedigs und dem östreichischen Kaiserstaate bezeichne und deshalb nicht ausspioniert werden solle. Ich erklärte mich dagegen weitläufig, daß nicht allein griechische und römische Altertümer, sondern auch die der mittlern Zeit Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen sei freilich nicht zu verargen, daß sie an diesem von Jugend auf gekannten Gebäude nicht so viele malerische Schönheiten als ich entdecken könnten. Glücklicherweise setzte die Morgensonne Turm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich fing an, ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschreiben. Weil aber mein Publikum jene belobten Gegenstände im Rücken hatte und sich nicht ganz von mir abwenden wollte, so drehten sie auf einmal, jenen Vögeln gleich, die man Wendehälse nennt, die Köpfe herum, dasjenige mit Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja der Podestà selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand, nach dem beschriebenen Bilde hin. Diese Szene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Mut sich vermehrte und ich ihnen nichts, am wenigsten den Efeu schenkte, der Fels und Gemäuer auf das reichste zu verzieren schon Jahrhunderte Zeit gehabt hatte.
Der Aktuarius versetzte drauf, das lasse sich alles hören, aber Kaiser Joseph sei ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Venedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Untertan, ein Abgeordneter sein, um die Grenzen auszuspähen.
»Weit entfernt«, rief ich aus, »dem Kaiser anzugehören, darf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr, Bürger einer Republik zu sein, welche zwar an Macht und Größe dem erlauchten Staat von Venedig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelstätigkeit, Reichtum und Weisheit ihrer Vorgesetzten keiner Stadt in Deutschland nachsieht. Ich bin nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt, deren Name und Ruf gewiß bis zu euch gekommen ist.«
»Von Frankfurt am Main!« rief eine hübsche junge Frau, »da könnt Ihr gleich sehen, Herr Podestà, was an dem Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; laßt den Gregorio rufen, der lange daselbst konditioniert hat, der wird am besten in der Sache entscheiden können.«
Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her vermehrt, der erste Widerwärtige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeikam, wendete sich die Sache ganz zu meinem Vorteil. Dieser war ein Mann etwa in den Fünfzigern, ein braunes italienisches Gesicht, wie man sie kennt. Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas Fremdes nicht fremd ist, erzählte mir sogleich, daß er [in Frankfurt] bei Bolongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Vergnügen erinnere. Glücklicherweise war sein Aufenthalt in meine jüngeren Jahre gefallen, und ich hatte den doppelten Vorteil, ihm genau sagen zu können, wie es zu seiner Zeit gewesen und was sich nachher verändert habe. Ich erzählte ihm von den sämtlichen italienischen Familien, deren mir keine fremd geblieben; er war sehr vergnügt, manches Einzelne zu hören, z. B. daß der Herr Allesina im Jahre 1774 seine goldene Hochzeit gefeiert, daß darauf eine Medaille geschlagen worden, die ich selbst besitze; er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin dieses reichen Handelsherrn eine geborne Brentano sei. Auch von den Kindern und Enkeln dieser Häuser wußte ich ihm zu erzählen, wie sie herangewachsen, versorgt, verheiratet worden und sich in Enkeln vermehrt hätten.
Als ich ihm nun die genaueste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Heiterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gerührt, das Volk erheiterte sich immer mehr und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wovon er freilich einen Teil erst in ihren Dialekt übersetzen mußte.
Zuletzt sagte er: »Herr Podestà, ich bin überzeugt, daß dieses ein braver, kunstreicher Mann ist, wohl erzogen, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von uns rede und sie aufmuntere, Malcesine zu besuchen, dessen schöne Lage wohl wert ist, von Fremden bewundert zu sein.« Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend.
Dieses alles ward für gut erkannt, und ich erhielt die Erlaubnis, mit Meister Gregorio nach Belieben den Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirt, bei dem ich eingekehrt war, gesellte sich nun zu uns und freute sich schon auf die Fremden, welche auch ihm zuströmen würden, wenn die Vorzüge Malcesines erst recht ans Licht kämen ... (Quelle:https://www.reise-nach-italien.de/goethe-italien1.html)

edruckt wurde schon vor Gutenberg per Holzdruck. Hierbei wurde Papier auf den bearbeiteten und mit Farbe versehenen Holzstock gelegt und abgerieben - ein aufwendiges und langwieriges Verfahren.
Grundgedanke der Erfindung Gutenbergs war die Zerlegung des Textes in alle Einzelelemente wie Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen, Ligaturen und Abkürzungen, wie sie aus der Tradition der mittelalterlichen Schreiber allgemein üblich waren. Diese Einzelelemente wurden als seitenverkehrte Lettern in beliebiger Anzahl gegossen, schließlich zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammengefügt. Urform oder Prototyp für jeden Buchstaben war der Stempel.
In die Stirnseite eines Stahlstifts wurde das Zeichen geschnitten, so dass sich ein seitenverkehrtes präzises Relief ergab. Nun wurde der jeweilige Stempel, die Patrize, in einen rechteckigen Block aus weicherem Metall, in der Regel wohl Kupfer, "abgeschlagen", d. h. senkrecht mit dem Schlag eines Hammers eingetieft. Die so erzeugte Matrize musste nachbearbeitet und begradigt werden, so dass eine rechtwinkliger Kubus mit geraden Seiten entstand. Das seitenrichtige Bild sollte eine einheitliche Tiefe haben, weshalb die Oberfläche mit einer Feile bearbeitet wurde.
Um den Guß einer Letter zu bewerkstelligen, entwickelte Gutenberg das Handgießinstrument. Zwei Teile umschließen einen rechteckigen Gießkanal, dessen eines Ende durch Einsetzen der Matrize verschlossen wurde. Nach dem Guß der Lettern im Handgießinstrument musste der Angusszapfen entfernt werden.
Jede Letter hatte eine "Sollbruchstelle", so dass alle Lettern automatisch die gleiche Höhe erhielten. Das Handgießinstrument, der bedeutendste Teil der Erfindung, ermöglichte es, im schnellen Wechsel die jeweils benötigten Mengen an unterschiedlichsten Lettern zu gießen. Das Gussmetall war eine Legierung aus Blei, Zinn und weiteren Beimischungen, die ein schnelles Erkalten und eine ausreichende Dauerhaftigkeit unter dem hohen Druck der Presse gewährleistete.
Die Druckerpresse, die gegenüber dem bis dahin bekannten Reiberdruck eine enorme Beschleunigung des Druckvorgangs bewirkte, war eine Spindelpresse mit spezieller Ausrüstung für die effektive und gleichmäßige Übertragung des Druckbildes von der Form auf das Papier oder auch das Pergament. (Quelle:https://gutenberg.de/erfindung/index.php)

„Sauwetter“, fluchte Admiral Sir Clowdisley Shovell über den Nebel, der ihm zwölf Tage lang auf See zugesetzt hatte. Nach siegreichen Gefechten mit der französischen Mittelmeerflotte war er am 29. September 1707 mit 21 Schiffen der Royal Navy von Gibraltar nach England aufgebrochen. Voller Sorge, seine Schiffe könnten auf Felsenriffe laufen, befahl der Admiral seinen Navigationsoffizieren, sich zu beraten. Nach übereinstimmender Meinung befand sich die Flotte in sicherem Abstand westlich von der Ile d´Ouessant. Doch die Offiziere hatten ihre Position falsch berechnet. Die Scilly-Inseln, zwanzig Meilen vor der Südwestspitze Englands, wurden zum namenlosen Grab für 2.000 Soldaten.
Der „Longitude Act“
Die Suche nach einer Methode zur Positionsbestimmung auf See beschäftigte Wissenschaftler, Seeleute und Politiker. Die Regierungen der seefahrenden Nationen versprachen hohe Belohnungen. Den höchsten Preis setzte das britische Parlament im „Longitude Act“ vom 8.Juli 1714 aus. 20.000 Pfund sollte derjenige erhalten, der eine Methode zur Ermittlung der geografischen Länge auf See fände.
John Harrison (1693-1776)
John Harrison, am 24. März 1693 in der Grafschaft Yorkshire geboren, stammte aus einfachen Verhältnissen und hatte das Tischlerhandwerk gelernt. 1713, mit knapp zwanzig Jahren, baute er seine erste Uhr, ohne eine Uhrmacherlehre absolviert zu haben. Weitere Uhren folgten. Niemand weiß, wann oder wie Harrison erstmals vom Preis der Längenkommission hörte. Vielleicht hatte er sich schon davor mit dem Problem auseinandergesetzt. Um eine auf der See zuverlässig funktionierende Uhr zu bauen, verzichtete er auf das Pendel und ersetzte es durch federnde, gegeneinander wirkende Schwingarme.
Mit dieser Uhr trat Harrison 1737 vor die Längenkommission. Obwohl seine Uhr auf der Probefahrt von London nach Lissabon nicht mehr als ein paar Sekunden Abweichung pro Tag gezeigt hatte, erklärte er, dass seine Uhr noch einige Mängel aufweise, die er zu korrigieren gedenke.
In den folgenden 20 Jahren perfektionierte er seine Ideen und vollendete 1759 seine vierte Schiffsuhr. Ein Buch mit den Plänen dazu erschien 1767.
Doch weitere Jahre vergingen, bevor Harrison belohnt wurde. Erst eine Intervention von König George III. verhalf ihm 1773, drei Jahre vor seinem Tod, zu seinem Geld.
John Arnold (1736-1799)
John Harrisons Uhren waren gut, jedoch aufwändig in der Herstellung und entsprechend teuer. Eine preisgünstigere Bauart entwickelte John Arnold. 1782 ließ er sich eine neuartige Hemmung und eine Kompensationsunruhe patentieren. Arnolds wesentliche Entwicklung bestand darin, dass die Unruhe nur ganz kurz mit dem Räderwerk in Verbindung steht, um das Fortschalten des Uhrwerks auszulösen.
Die erste Schiffsuhr mit der neuen Hemmung war die Nummer 13. Das Deutsche Uhrenmuseum besitzt die Nummer 16, hergestellt vermutlich 1783.
Arnolds Erfindung veränderte die Positionsbestimmung auf hoher See. Dank Sextant und Chronometer, wussten die Seeleute nun auch nach wochenlanger Fahrt auf offenem Meer, wo sie sich befanden.
So auch Kapitän Thomas Welladvice, der 1789 mitten in der Nacht aufgrund der Positionsbestimmung mit seinem Arnold-Chronometer feststellte, dass sein Schiff in der Nähe der Scilly-Inseln sein müsse. Um Mitternacht ließ er die „Barwell“ festmachen, bei Tagesanbruch sah er die Felsen vor sich. Die Tragödie von 1707 wiederholte sich nicht.